Dr. Erna R. Fanger und Hartmut Fanger MA
Seit über 25 Jahren erfolgreiche Dozenten für Kreatives und Literarisches Schreiben, Fernschule, Seminare, Lektorat
www.schreibfertig.com: Aktuelle Buchtipps

Buchtipp des Monats Juni 2025
© Hartmut Fanger
1958:
hinter der Fassade eines in sich zerrissenen Deutschlands
Carlo Levi: Die doppelte Nacht. Eine Deutschlandreise im Jahr 1958, Verlag C.H.Beck GmbH & Co, KG, München 2024 –
5. Auflage 2025.Aus dem Italienischen von Martin Hallmannsecker, mit einem Nachwort von Bernd Roeck
Von Goethes Faust, zweiter Teil, ausgehend, dem der Titel in Anlehnung an den dort verwendeten Begriff „Doppelnacht“ entliehen ist, startete Levi (1902-1975) vor 67 Jahren, 13 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Reise durch Deutschland. Einem größeren Publikum bekannt wurde der italienische Autor jüdischer Herkunft mit der zum Klassiker avancierten literarischen Dokumentation Christus kam nur bis Eboli (Gleichnamiger Film unter der Regie von Francesco Rosi, 1979). Nicht nur Homme de Lettres, war Levi außer Schriftsteller auch noch Maler und Arzt. Im Übrigen wirkte er im Widerstand gegen Mussolini, wurde im Zuge dessen zwischenzeitlich eingesperrt und auch aufs Land verbannt.
Wie er in „Die doppelte Nacht“ wiederum die Atmosphäre des Wirtschaftswunders und deutsche Mentalität nach dem Zweiten Weltkrieg in seinen subtilen Ausdifferenzierungen beobachtet und entsprechend nahebringt, ist sprachlich meisterhaft. Darunter nicht zuletzt die allesamt unter den Tisch gekehrten Schattenseiten. Dabei liegt der besondere Reiz in der von Levi bewusst gewählten wertfreien Perspektive –‚alles offen‘, als ‚hätte die Zeit Erinnerungen mit sich fortgerissen.‘ Zugleich an die unvoreingenommene Art gemahnend, wie Kinder die Welt wahrnehmen. „Und unsere Augen und unser Geist können, frei von Leidenschaft und auch von den tödlichen und unerschütterlichen Überresten der Leidenschaften, von den alten Fragen, wie auf etwas Neues blicken.“ Leseprobe
So spannend wie unterhaltsam und aufschlussreich Levis Blick auf die großen, vom Wiederaufbau geprägten Städte, die bei aller Modernität und Überangebot an Lebensmitteln und sonstigen Konsumgütern im Westen angesichts der zahlreichen Ruinen zugleich eine spürbare Leere hinterlassen. Von München aus zunächst nach Augsburg, dann über Ulm nach Stuttgart. Von dort aus nach Berlin. Kurze Zwischenstationen Dachau und Tübingen. Die kleineren Städte hingegen sind aus seiner Sicht „in Bezug auf das, was sie einmal waren, tot: zertrümmert von den Bomben, neu und unkenntlich wiederaufgebaut oder geschickt gefälscht.“ Leseprobe
Eine Ausnahme Schwäbisch Hall, Kleinstadt „die praktisch vollständig unversehrt geblieben und deren Steine noch die alten sind, nicht bloß Nachbildungen eines guten Wiederaufbauwillens“. Leseprobe
Die Aufzeichnungen Levis von Berlin leben wesentlich vom Kontrast zwischen Ost und West. Auf der einen Seite ‚Üppigkeit und Glitzerwelt, auf der anderen Rückständigkeit und Natürlichkeit‘. Levi wiederum erkennt darin ‚zwei Seiten einer Münze‘. Gemeinsam ist ihnen ‚hier wie dort das Exzessive, Erzwungene und Künstliche‘.
Eine Vorführung, mehr Schaufenster als Realität, ein beharrliches Zurschaustellen von Sicherheit, die jedoch auf eine große Leere gebaut ist, als wären die Häuser auf der gefrorenen Oberfläche eines Sees errichtet worden, die die Frühlingssonne auf einen Schlag schmelzen und einbrechen lassen könnte. Leseprobe.
Frappierend, von welcher Reichweite, ja Brisanz sein Bericht ist. So, wenn er von einer seiner nächtlichen Begegnungen bemerkt: „Alle ... geben sich menschlich, aber es sind noch immer dieselben wie früher. Meine Brüder waren fürchterliche Nazis: Heute sind sie immer noch Nazis“ Leseprobe Und das, wo nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa samt den USA zunehmend rechtspopulistische Strömungen Fahrt aufnehmen.
Aufschlussreich das ausgezeichnete Nachwort von Bernd Roeck, aus dem zu entnehmen ist, dass Deutschland für Levi das Land sei, das Mephisto für Faust ins Leben gerufen habe. Streitbare These, die dahingestellt sei.
Davon abgesehen, ein Buch, das die Folgen bis heute der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs in der Tiefe ausleuchtet. Insofern ein Buch zur rechten Zeit, wo uns der Schrei nach Wiederaufrüstung nur allzu laut in den Ohren gellt. Ein Buch, das uns das „Nie wieder Krieg“ nach 1945 in Erinnerung bringen mag – fürs Geschichtsbewusstsein nahezu unerlässlich.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Beck-Verlag, München!

© Hartmut Fanger
Cannabis als Schlüssel der DDR zur „Jugend der Welt im Geiste des Sozialismus“
Jakob Hein: Wie Grischa mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste, Verlag Galiani, Berlin 2025“
Wie sollte das gehen? Zwei völlig voneinander getrennte Welten in Einklang zu bringen? Wie kommt es dazu, dass die einstige DDR mit all ihrem sozialistischen und von Bürokratie geprägten Gedankengut aus Afghanistan Cannabis bezieht, um es im Westen gegen teure Devisen zu verkaufen. Eine im wahrsten Sinne des Wortes ‚verrückte‘ Vorstellung, die in dem neuesten Roman „Wie Grischa mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste“ von Jakob Hein meisterhaft, mit jeder Menge Sinn für Humor und Phantasie, literarisiert wird.
Dazu gehören natürlich fundamentale Kenntnisse, sowohl was den Alltag der ehemaligen DDR und deren Gesetzmäßigkeiten betrifft, als auch der Droge Cannabis und deren Anbau, die in dem Roman sehr wohl zum Tragen kommen. Sei es, wenn von der fehlenden Arbeitsmoral in den Führungsetagen der Planungskommission die Rede ist, oder von der Fabrikation des ‚Schwarzen Afghanen‘ in den eigens dafür errichteten Produktionsstätten Afghanistans.
Köstlich, wenn dann von dem übermotivierten und aufstrebenden jungen Titelhelden Grischa aus der eigens von ihm entwickelten Beschäftigungsmaßnahme – es gibt sonst definitiv nichts zu tun – die Initiative ausgeht, mit einem Land, das wahrlich nichts außer Drogen zu bieten hat, ins Geschäft zu kommen. Sein Ass im Ärmel sind mögliche Einnahmen, die vom Staat so dringend benötigt werden und die schließlich auch den Ausschlag für die Umsetzung des wahnwitzig anmutenden Unterfangens geben. Junge Westler versprechen immerhin eine veritable Zielgruppe ...
Doch damit nicht genug. Als der Laden so richtig ins Rollen kommt, der schwarze Afghane zunächst reißenden Absatz findet, führt die Spur doch glatt und ausgerechnet zum bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Was es damit auf sich hat und warum dieser letzten Endes mit einem Milliardenkredit aufwartet, sei an dieser Stelle nicht verraten. Zu enträtseln bleibt schließlich dem geneigten Leser, wo in diesem wunderbaren Buch Wahrheit aufhört und Dichtung beginnt. Alles in allem ein Lesevergnügen erster Güte!
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Galiani Verlag, Berlin!
Buchtipp des Monats April - Mai 2025

© Hartmut Fanger
Von Sex, Drugs , virtueller Welt und Toilettengängen
Etgar Keret: Starke Meinung zu brennenden Themen. Aus
dem Hebräischen von Barbara Linner, Aufbau Verlag, Berlin 2025
Ein neuer Stern am Himmel der Kurzgeschichte: Der 1967
geborene israelische Autor Etgar Keret gilt als einer der
originellsten Schriftsteller seiner Generation. Laut Daniel
Kehlmann »Großmeister einer Gattung, die nur er schreiben kann:
die Etgar-Keret-Kurzgeschichte ... Keret wird von Buch zu
Buch besser darin... dieser Band ist der bisherige Höhepunkt seines
Schaffens.« Nicht von ungefähr also wird sein neuester ‚Wurf‘,
Starke Meinung zu brennenden Themen – vielfach übersetzt –,
unter Kennern gefeiert.
Mit überbordender Fantasie schreiben sich hier Absurdität und Aporie menschlicher Existenz in vielfältiger Spiegelung in seine Storys ein. Spielerisch leicht, gespickt mit Weisheit und Witz, schriller Komik und tiefgründigem Humor.
An Skurrilität wiederum ist Keret kaum zu überbieten. Beispielsweise wenn der Ich-Erzähler auf dem Balkon seiner Wohnung Oliven essend auf den Weltuntergang wartet und die Meinung vertritt, dass ‚nichts über ein paar Sterne am Himmel und eine grauenhafte argentinische Telenovela auf dem Bildschirm‘ gehe, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Heiter und nicht weniger tiefgreifend die Geschichte „Genesis Kapitel 0“, worin nach einem Unfall zunächst nahezu ausschließlich „Schmerz“ regiert, im Anschluss daran, nach einem Prozess der Heilung des Protagonisten, Langeweile das Feld beherrscht, um dann im Zuge der Geburt des eigenen Kindes in einen Zustand der Erschöpfung zu münden. Später führt all dies zu Ärger, und als die Einberufung zum Militär folgt, zu Angst und Frustration. Angesichts der hier meisterhaft komponiert zur Sprache kommenden Dilemmata, obendrein gewürzt mit schön schrägem Humor, spiegeln uns die Geschichten die Bandbreite des ganz normalen alltäglichen Wahnsinns.
Ins Auge fällt, dass sich gewisse Aspekte in Kerets Geschichten wiederholen. So etwa wird außergewöhnlich oft von Toilettengängen, Reality TV, Talkshows oder virtuellen Welten erzählt. Ebenso von „Parallelwelten“, wo zum Beispiel Protagonistin „Debbie zugleich als „Nicht-Debbie“ in Erscheinung tritt. Weniger über Gott, der eher ex negativo zur Sprache kommt, wird vielmehr über Sex gesprochen.
Alles in allem ein Kurzgeschichtenband, der den Leser gezielt irritiert und damit nicht nur amüsiert, sondern auch zum Nachdenken anregt.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Aufbau Verlag, Berlin!
Buchtipp des Monats April 2025

© Hartmut Fanger:
Von Glück und Unglück der runden Zahl
Es ist nur eine Zahl, Jakob, sagte ich, und dachte: Nicht einmal die schlimmste, die schlimmsten Zahlen standen uns noch bevor, wenn alles gut ging. Nichts sei jemals nur eine Zahl, entgegnete er und zündete sich eine Zigarette an.
Lucy Fricke: „DAS FEST“
Claasen – Ullstein Verlag, Berlin 2024
Der 50. Geburtstag des besten Freundes der Ich-Erzählerin bildet hier den Mittelpunkt. Jakob und Ellen hätten in so vielen Jahren und auf so vielen gemeinsamen Reisen ein perfektes Paar abgeben können. Doch hatte es bisher nur zu einer Freundschaft gelangt. Der runde Ehrentag Jakobs sollte in dieser Beziehung nun den Wendepunkt einläuten. Doch Jakob ist ausgelaugt, in seinem Beruf als Filmemacher gescheitert und hat alles andere, als Lust zu feiern. Ellen wiederum lässt sich etwas einfallen.
Nach gründlicher Recherche arrangiert sie Begegnungen mit Personen aus
seinem Leben. Sei es mit der einstigen Lebensgefährtin, die sich von ihm trennte, weil sie ein Kind wollte, er nicht. Dann will es ‚der Zufall‘, dass er seinen alten Freund Inken trifft, mit dem er nicht nur Jahre lang eine Wohnung teilte und als Filmregisseur zusammenarbeitete, sondern mit dem ihn überdies eine traumatische Erfahrung verbindet. Aber auch der indischen Sandkastenfreundin Neela, begegnet er wieder und hilft ihr in ihrem neuerworbenen Restaurant beim Zubereiten der Speisen.
Die Panik Jakobs, mit dem 50. am Abgrund angelangt zu sein, wird durch Ellens wirkmächtiges ‚Einschreiten‘ insofern konterkariert, als sie dadurch Erinnerungen an die vielen Momente glücklichen, liebevollen Miteinanders in seinem bisherigen Leben wachruft.
Einzuwenden mag sein, dass der ansonsten gut durchkomponierte Roman an manchen Stellen doch ein wenig erzwungen, sprich konstruiert wirkt. So etwa, wenn Jakob in so gut wie jedem Kapitel ein Desaster ereilt. Vom verlorenen Schneidezahn, gefolgt von einem blauen Auge, gequetschten Daumen, bis zum schmerzlich sich in Erinnerung bringenden geknickten Fuß beim Übersehen einer Stufe. Da stellt sich dann schon die Frage, was, wie manch namhafter Rezension zu entnehmen, daran ‚menschenfreundlich‘ sei, wenn Jakob ausgerechnet an seinem 50sten stets ‚eins in die Fresse kriegt‘ – so seine eigenen Worte – und letztlich arg ramponiert aus der Geschichte hervorgeht. So mag das dem Buch bescheinigte ‚Leseglück`* zugleich auch auf einer Art Schadenfreude beruhen.
Nichtsdestotrotz, Lucy Fricke ist mit „Das Fest“ wahrhaft ein kleines Meisterwerk gelungen, das sich humorvoll, wunderbar leicht liest und zum Nachdenken anregt. *Ann-Dore Krohn, Radio 3
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl
Buchtipp es Monats Februar-März 2025

© Hartmut Fanger
Ganzheitliche Krisenbewältigung À la Meyerhoff
Joachim Meyerhoff: Man kann auch in die Höhe fallen Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2024
Um die Bewältigung einer Krise geht es nun im sechsten Teil des Meyerhoffschen Romanzyklus‘ Man kann auch in die Höhe fallen. Und so ernst der Anlass – immerhin hat der Ich-Erzähler gerade einen Schlaganfall hinter sich –, so urkomisch nehmen sich die 355 Seiten ganzheitlicher Krisenbewältigung aus. Hautnah erleben wir, wie der schriftstellernde Protagonist und Ich-Erzähler, zugleich Schauspieler, sich in das Leben zurückarbeitet und im Zuge dessen feststellen muss, dass all das, woran er zuvor geglaubt, was er geplant und betrieben hatte, aus dem Ruder gelaufen zu sein scheint. Er fühlt sich elend und flüchtet. Und zwar an die Ostsee, zu seiner Mitte achtzigjährigen Mutter – strotzend vor Vitalität und Unternehmungsgeist. Stringent deren Lebensführung, geprägt von Gartenarbeit, regelmäßigem Schwimmen und Tauchen im Teich, täglichem Saunagang, Mitgliedschaft im Chor und nicht zuletzt der zu diesem Ablauf gehörenden Whiskeystunde. Von ihrer Leidenschaft für überhöhte Geschwindigkeit beim Autofahren ganz zu schweigen. Die Mutter ist es schließlich auch, die den lädierten Protagonisten dazu bringt, endlich wieder zu schreiben. Sie hört ihm, so manche Episode aus der Vergangenheit teilend, zu, verpasst Ihm Fußzonenreflexmassagen und überträgt ihm jede Menge Aufgaben im parkähnlichen Garten. Unter ihrer Kuratel findet er so allmählich wieder ins tätige Leben zurück. Darüber hinaus sind es Zufälle, die zu dieser rundum Gesundung beitragen. Etwa wenn ihm ein Friseur nicht nur Haare schneidet, sondern mit heißem Wachs und Holzstäben Ohren und Nase öffnet, so dass er folglich besser hören und riechen kann und, mit dem Rücken an einen Windradturm gelehnt, das Gefühl hat, zu neuer Energie gelangt zu sein.
In relativ kurzen Kapiteln erfährt der Leser im Rahmen von Rückblenden Anekdoten aus dem Leben des Ich-Erzählers, darunter teils traumatische Ereignisse in Berlin oder Wien. Städte, in denen er mehrere Jahre gelebt und als Schauspieler gearbeitet hat. Insbesondere zu schaffen gemacht hat ihm der Umzug von Wien nach Berlin. Dies spiegelt sich etwa in der Episode seines verlorenen Koffers wider, in der anschaulich erzählt wird, in welch skurrile Verwicklungen es münden kann, wenn einer wie er, von Krisen geschüttelt, eine verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit hat. So, wenn er vehement darauf beharrt, den Koffer an einer bestimmten Stelle im Hotel platziert zu haben, Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um am Ende kapitulieren und zugeben zu müssen, dass dem definitiv nicht so war. In zahllosen weiteren Episoden so tragischen wie humorvollen Inhalts versteht es Meyerhoff, den Leser mit immer wieder überraschenden Momenten, Witz und seinem eigentümlich liebenswerten Humor bestens zu unterhalten und ihm so manches Lächeln auf die Lippen zu zaubern.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl
Buchtipp des Monats Dezember 2024

© Hartmut Fanger
Von der Sehnsucht, weit weg, gar im All
Finsternis. Hier bleibe ich. Halte die Luft an. Nicht halbherzig, sondern ernst, auch um einen Stern fehlt Sauerstoff, hier muss ich leben lernen.
Barbara Zeman, Beteigeuze
Barbara Zeman: Beteigeuze, Deutscher Taschenbuch Verlag DTV, München 2024
Sehnsucht, weit weg zu sein. Am liebsten fernab im Sternbild des Orion, wozu der wenig bekannte Stern von gigantischer Größe mit dem seltsamen Namen „Beteigeuze“ gehört. Auf 300 Seiten kommt dieser titelgebend zum Tragen. Wie überhaupt das Weltall für die vierzigjährige, von Depressionen geplagte Protagonistin Theresa Neges zu einer Art Obsession wird. Neges wiederum bedeutet soviel wie ‚Du solltest Nein sagen‘. Aus der Nervenanstalt entflohen, avanciert ihre Wohnung zu einer Raumfahrtzentrale à la ESA oder NASA, die Decke versehen mit leuchtenden Sternen. Hier kann sie sich „Beteigeuze“ nahe fühlten. Letzten Endes fungiert jener ‚nur im Herbst sichtbare, rötlich leuchtende Riesenstern, dieses von Weltraumschrott und Staubwolken umgebene Gebilde‘ als Art Spiegelfigur. „Halb so kühl wie die Sonne. Zehntausendmal heller als sie“ Leseprobe, empfindet Theresa sich selbst als ebenso strahlend wie Beteigeuze. „Gleich wie mein Stern strahle ich hell, und manchmal strahle ich finster" Leseprobe – so Theresa.
Weit entfernt von den üblichen alltäglichen Pflichten und Obliegenheiten scheint Theresa auch sonst zu sein. Ohne Beruf und ohne Geld am gesellschaftlichen Rand. Sei es am Strand in Venedig, in Wien auf dem Rummelplatz, wo sie, auf einem Karussell von Schwindel erfasst, eine Fantasiereise ins All antritt. Bewusst will sie ohne Geld eine Birne kaufen und übt im Hallenbad nach Vorbild eines verstorbenen Tauchers, die Luft anzuhalten ... Theresa, so komisch wie tragisch gezeichnet, immer nur bedingt dazugehörig, dabei stets zwischen Himmel und Erde schwebend, manisch-depressiv, was auch für ihre Beziehung Josef zutrifft, dessen Liebe sie sich nie ganz sicher sein kann.
Keine Plot-Geschichte, vielmehr experimentell erzählt, lebt Beteigeuze nicht zuletzt von der gekonnt eingesetzten poetischen Bildersprache, von genial konstruierten Satzkombinationen sowie den kunstvoll gebauten authentischen Dialogen – kurz von seiner Sprachschönheit: „In Wien ist unsre Wohnung dunkelblau, am Meer ist sie orange. Wir haben das schlechte Wetter verpasst, aber die Reste des Regens sind noch nicht aus den Zimmern verschwunden. Ein Vorhang bewegt sich langsam.“ Leseprobe Ein Roman von der Leuchtkraft des Sterns, von dem er erzählt, so hell wie „Beteigeuze“.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dtv München
Buchtipp des Monats November - Dezember 2024
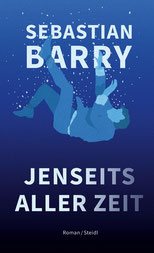
© Hartmut Fanger
Zwischen Erinnerung und Fantasie
Sebastian Barry: Jenseits aller Zeit. Aus dem Englischen
von Hans-Christian Oeser, Steidl Verlag, Göttingen 2024.
Sebastian Barrys neustes Werk bietet alles, was einen guten Roman ausmacht. Meisterhaft erzählt und genial komponiert, es ist ebenso
geheimnisvoll wie von der ersten Seite an spannend. Schließlich ist Protagonist Tom Kettle pensionierter Kriminal-Polizist und weiß von so manchem seiner Fälle zu erzählen. Doch dies ist nur eine der vielfach sich überlagernden Erzählebenen und -schichten, in denen sich sensible Wahrnehmungen der Gegenwart mit teils brisanten,
teils außergewöhnlichen Ereignissen aus der Erinnerung kreuzen.
Wobei das Changieren zwischen Realität und Fantasie einen besonderen Reiz entfaltet. Nicht selten bleibt im Dunkeln, inwieweit die Ausführungen des Ich-Erzählers wahr oder frei erfunden, die Erinnerungen stimmig sind oder eher Wunschgedanken entsprechen, oder ob sie überdies einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber Umwelt und Mitmenschen entspringen. Dies alles bleibt gekonnt vage, fordert dementsprechend die Fantasie Lesers heraus.
Fest steht, dass Tom Kettle in einem Mietshaus allein und verwitwet an der irischen Küste lebt und während eines schweren Unwetters eines Abends von zwei jungen Kollegen unerwartet Besuch erhält. Er wird bei einem alten Fall um Hilfe gebeten, seine Berufserfahrung noch einmal wertgeschätzt. Dementgegen fühlt er sich jedoch nicht in der Lage, den beiden Männern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Er lebt inzwischen altersgemäß und, wie bereits der Titel verrät, ‚aus der Zeit gefallen‘ in seiner eigenen Welt. Eingesponnen in Erinnerungen an seine verstorbene Frau und seine ebenso verstorbenen Kinder, an ehemaligen Kollegen ..., das Ganze in tragikomischer Manier zum Besten gegeben.
Darüber hinaus enthält der Roman eine Fülle an Zeit- und Lokalkolorit, wie etwa „Schnappschüsse und Porträts aus längst vergangenen Zeiten, aus dem fremden Land der sechziger Jahre“ Leseprobe. Oder wenn die Frau des Protagonisten mit der neuerworbenen Jeans in die Wanne steigt, damit sie einläuft und Figur gerecht am Körper sitzt. Wer der älteren Semester unter den Lesern erinnert sich nicht daran. Aber auch Film und Musik spiegeln jene Zeit wider, „Rain drops keep falling on my head“ oder Cat Stevens „Oh baby, baby it’s a wild world“. Ebenso haben wir daran teil, wie die irische Jugend die Kinos stürmt, als ”Viva Las Vegas“ mit Elvis Presley gebracht wird, andererseits vom Vietnam-Protest erfasst wird. Hinzu kommen Momentaufnahmen, etwa wie ihm beim Anblick ‚der schönen Nähte‘ eines Anzugs die Erinnerung an die vielen indessen brach liegenden Bahnstrecken in den Sinn kommt: „Schade, dass dieser idiotische Minister in den sechziger Jahren all die kleinen Nebenstrecken in Irland stillgelegt hatte. Nicht profitabel. Aber schön. Nicht, dass sich irische Regierungen sonderlich um Schönheit scherten. Sie stoppten den Blutstrom von Besuchern in tausend Städten“ Leseprobe
Faszinierend im Übrigen die grandiosen Landschaftsbeschreibungen sowie die plastische Skizzierung des Ambientes, worin sich Gegenwart und Vergangenheit gegenseitig durchdringen:
Zu Beginn hatte ihn das Rauschen des Meeres unterhalb des Panoramafensters gelockt, inzwischen aber gefiel ihm alles an diesem Haus – die neugotische Architektur einschließlich der unnützen Zinnen auf dem Dach, das Heckengeviert im Garten, das als Windschutz und als sonniges Fleckchen diente, die Landestege aus gebrochenen Granitsteinen, die Insel, die sich in naher Ferne versteckt hielt, selbst die zerfallenden Abwasserrohre, die vom Ufer ins Wasser ragten. Die beschaulichen Gezeitentümpel erinnerten ihn an jenes leicht zu faszinierende Kind, das er einst, vor sechzig Jahren, gewesen war, und die fernen Rufe der heute in ihren unsichtbaren Gärten spielenden Kinder bildeten dazu eine Art diffus quälenden Kontrapunkt. Diffuse Qual, das war seine Stärke, dachte er. Der herabstürzende Regen, das herabstürzende Sonnenlicht, die armen heldenhaften Fischer, die sich abgemüht hatten ...“ Leseprobe
Ein Roman von bemerkenswerter literarischer Intensität, den wir nur empfehlen können.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Steidl Verlag, Göttingen!

Buchtipp des Monats Oktober 2024
© erf
Wenn aus Nöten Flügel wachsen ...
Manchmal kann die erneute Lektüre so schön und unvorhersehbar sein wie die Begegnung mit einer alten Liebe.Fabio Stassi
Fabio Stassi: Die Seele aller Zufälle. Detektivroman. Edition CONVERSO, Karlsruhe 2024. Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki
Der vielfach mit Preisen ausgezeichnete Autor für Kinder ebenso wie für Erwachsene, zugleich Songwriter Fabio Stassi – belesener Freigeist, unkonventionell, ideologiefrei zwar, dafür aber umso politischer, stammt aus einer Emigrantenfamilie, in der viele Weltreligionen zusammentreffen. In den Literaturen querbeet durch die Welt ist er ebenso bewandert wie er seinen Helden Vince Corso mit seinen Lesern durch Roms berühmtes Monti-Viertel unweit des Kolosseums flanieren lässt, mit ihm seine Lieblingsbuchhandlung besucht oder in seiner abseits gelegenen Lieblingsbar abhängt, wohin er sich gern mit einem Rossa-Bockbier zurückzieht, um stundenlang zu lesen.
Bei „Die Seele aller Zufälle“ handelt es sich um den zweiten Band mit dem groß angelegten Antihelden und Bibliotherapeuten aus Rom, Vince Corso, dem zugleich die Rolle des Detektivs, obschon meist nicht ganz freiwillig, zukommt. Corso, einer, der eher neben sich, als ‚mit beiden Beinen auf der Erde‘ steht, geht täglich mit seinem stummen Hund Django spazieren. Einst Gymnasiallehrer, ist er, was allein schon berufshalber naheliegt, passionierter Leser, spielt Schach, aber keine Partie zu Ende, liebt französische Chansons. An die Liebe glaubt er „schon seit einem Herbst und einem Winter nicht mehr.“ Leseprobe Seine in der Regel weiblichen Patienten empfängt er in einer Dachgeschosswohnung in der Via Merulana. Damit hat er ein unerschöpfliches Terrain für so skurrile wie schicksalsträchtige Begegnungen geschaffen, die der Tristesse, die ihn wie ein unsichtbares Gewebe umfängt, Farbe verleiht.
Unerwartet sieht er sich seitens einer Auftraggeberin, einer eleganten Dame um die 60, mit einem kniffligen Fall, dazuhin nicht unerheblichem Honorar konfrontiert: Ihr Bruder, weit gereist und Homme de Lettres, an Alzheimer erkrankt, spricht immer wieder dieselben Sätze vor sich hin, offenbar Zeilen aus einem Roman, in dem er sein Testament versteckt haben könnte. Die Auftraggeberin vermutet, dass, gelänge es herauszufinden, aus welchem Werk die gemurmelten Sätze stammten und es ihrem Bruder vorzulesen, dies seinem Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen könnte. Nachdem sie Corso Zugang zu dessen „Wunderkammer“, einer reich gefüllten Bibliothek, gespickt mit Bücherschätzen, darunter manch‘ wertvolle Rarität, erteilt, beginnt eine Art Odyssee für ihn: Durch Texte und Zeichen, verdeckte Hinweise und Verdachtsmomente. Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ist besagter Bruder Täter oder Opfer. Stelle, an der der Bibliotherapeut angehalten ist, zum Detektiv zu mutieren.
In einem anderen an ihn herangetragenem Fall wendet sich eine 70-jährige an ihn mit dem sie bedrängenden Anliegen, vergessen zu wollen: All die schmählichen Lagen, derer sie sich schäme und die sich bis ins kleinste Detail in ihr Gedächtnis eingebrannt zu haben schienen, sie quälten und ihr das Leben zur Hölle machten.
Es ist der Stoff des Lebens, der hier in poetischen Fragmenten, dramatischen Episoden, mal melancholisch, mal unter Hochspannung, nicht nur zur Sprache kommt, sondern überaus eloquent sprudelt. Tragikomisch und berührend, mal zum Weinen, mal zum Lachen. Dabei stets überraschend. Und es ist der Stoff, aus denen Bücher sich speisen, die in diesem Roman eine so zentral wie existenzielle Rolle spielen, aber auch in poetischer Theorie und rezeptionsgeschichtlich erhellt werden, lebendig und unterhaltsam rübergebracht.
Last but not least gebührt der verlegerischen Verve Bewunderung und Respekt, verdankt sich „Die Seele aller Zufälle“ doch dem Mut des Ein-Frau-Verlags Converso, begründet 2019 von Monika Lustig. Dass sie damit einen regelrechten Coup gelandet hat – Fabio Stassi erhält dafür den diesjährigen Hermann-Kesten-Preis des deutschen Pen – ist umso erfreulicher. GRATULATION!
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt Edition Converso, Karlsruhe!

Buchtipp des Monats September-Oktober 2024
© Hartmut Fanger
»In jedem Menschen steckt ein zurückgetretener König« Arno Geiger
Auf den Spuren Karl des V. in seiner letzten Lebensphase
Arno Geiger: Reise nach Laredo, Hanser Verlag, München 2024
Was, wenn sämtliche Statussymbole für einen Menschen wegfallen, er sich, aller Hüllen entledigt, der Existenz sozusagen nackt gegenübersieht. Was bleibt da noch? Im wahrsten Sinne des Wortes ergeht es so dem Protagonisten in Arno Geigers neuesten Roman: dem spanischen König Karl der V., einem der renommiertesten Herrscher des 16. Jahrhunderts, der sich von seinem Amt verbschiedet und sich, von Krankheit gezeichnet, in seinen letzten Lebensjahren in ein Kloster zurückzieht.
Nach Arno Geigers ungemein erfolgreichen Roman “Mein glückliches Geheimnis“ nun ein 272 Seiten umfassender Historienroman. Und es gibt auch hier wieder solch einen glücklichen Moment. So, wenn der Protagonist, allen Pflichten enthoben, noch einmal so etwas wie Freiheit für sich entdeckt, nämlich als er zusammen mit dem elfjährigen Geronimo bei Nacht und Nebel auf Pferd und Maulesel aus dem Kloster flieht. Und auch einem Geheimnis, das den Reiz des Ganzen ausmacht, kommt einmal mehr Bedeutung zu: Der elfjährige Geronimo weiß nicht, dass es sich bei dem alten kranken Mann um seinen Vater handelt.
Unschwer zu erkennen ist bei fortschreitender Lektüre, dass es sich bei Geigers „Reise nach Laredo“ zugleich um die Adaption eines Meilensteins der Weltliteratur, sprich von „Don Quijote“, handelt: Karl und Geronimo (Sancho Pansa ähnlich) weisen dementsprechend durchaus konkrete Zuge der Figuren des Romans von Cervantes auf und erleben im Kampf um Gerechtigkeit mit Hieb und Stich ebenso zahlreiche Abenteuer wie sie sich natürlich auch mit den sagenumwobenen Windmühlen konfrontiert sehen.
Zum anderen handelt es sich bei der Tour aber auch um eine Reise nach Innen. Auf dem Weg Richtung Meer, dem Tode nah, lässt Karl noch einmal sein Leben Revue passieren und stellt sich dabei so manche Frage: „Kann man Unbeschwertheit lernen? Wird man so geboren?“ Leseprobe Ebenso kommt ihm die ein oder andere Erkenntnis in den Sinn, so etwa: „Er sah seinen Lebensweg, der sich von einem Krieg zum anderen schlängelte, von einem Friedensvertrag zum anderen, von einem Vertrauensbruch zum anderen. Und um wie viel besser war die Welt nach all der Mühe?" Leseprobe
Karl wirklich von Bedeutung gewesen. Um das zu erforschen, bleibt ihm allerdings nicht viel Zeit. Zeit wiederum lohnt es sich durchaus, in Geigers Fabulier-und Formulierlust zu investieren, indem er zum einen eine authentisch anmutende mittelalterliche Gedankenwelt und Ausdrucksweise lebendig nahebringt, zum andern, wie jede große Literatur völlig zeitlos rezipierbar ist.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank gilt dem Hanser Verlag

Buchtipp des Monats
September - Okotober 2024
© erf
Neu Aufbrechen, Frühschwimmen – Glu:ck finden ...
An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser Charlie Chaplin
Thomas Einfeldt: Frühschwimmen und Glu:eck finden. Novelle. BoD, Hamburg 2025
Neben seinem Brotberuf als Zahnarzt hat Thomas Einfeldt drei historische Romane, zwei Jugendbücher und ein Sachbuch veröffentlicht. Umso gespannter darf man nun auf sein jüngstes Werk sein, wo es, in Anverwandlung des Titels des berühmten Goethe-Gedichts, um „Willkommen und Abschied“ geht. Wobei zunächst einmal naturgemäß Letzteres, nämlich der Abschied, im Vordergrund steht. Stehen die beiden Protagonisten doch wiederum – ein jeder für sich in der Lebensmitte – vor den Scherben ihres Glücks. Der Ich-Erzähler arbeitslos, von seiner Frau verlassen. Das Leben der Sie-Stimme nach dem langsam sich dahinziehenden Tod ihres Mannes aus den Fugen. Doch noch liegt ein Aufeinandertreffen der beiden Protagonisten in weiter Ferne.
Und das mag auch ihr Glück sein, haben sie beide doch genug zu tun, das heftig ins Schwanken geratene Lebensschiff wieder auf Kurs zu bringen. Was sie schließlich auch bewegt, die Schwimmoper als Frühsport für sich zu entdecken und schätzen zu lernen. Wobei es sich bei besagter Location um keine Oper handelt, sondern um ein Hallenbad in Hamburg von bemerkenswerter Architektur, an die Oper von Sidney erinnernd. Gleichwohl eigen die Spezies der Frühschwimmer, in der Regel eher mittleren Alters, der Fitness bewussten Mittelschicht zugehörig. Zugleich farbige Klientel, die Einfeldt offensichtlich genau studiert hat und dem Leser hier mit nachsichtigem Blick, nicht ohne teils wohlwollende, teils schärfere Ironie präsentiert.
Dies sind, neben manch einer Passage, in denen die Nöte der Betreffenden so einfühlsam wie facettenreich und nicht zuletzt fantasievoll zur Sprache kommen, mit die vergnüglichsten Stellen des Romans. Verdichtetes Leben, verletzliches Leben. Der meist unvollkommene Körper mit dem Nötigsten bedeckt, den Blicken der anderen ausgesetzt. In einem gesellschaftlichen Klima von Körper-, Fitness-, obendrein Jugendkult und Selbstoptimierungsgebot eine Challenge, der sich keiner ohne Weiteres zu entziehen vermag und wo jeder seine eigenen Strategien entwickelt, sich zu positionieren. Hier werden Letztere so vielseitig wie mit Witz aufs Korn genommen.
Inwieweit die Anhänger des Frühschwimmens, soweit Singles, letzten Endes allesamt von der Hoffnung beseelt sein mögen, in diesem Umfeld doch noch auf die Liebe ihres Lebens zu stoßen, sei dahingestellt. Den beiden hier präsentierten Protagonisten jedenfalls – weit davon entfernt, dies forcieren zu wollen – ist die zarte Sehnsucht danach nicht abzusprechen. Ob sie sich erfüllt, bleibt offen ...
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Autor!

Buchtipp des Monats August/September 2024
© erf
Auszeiten oder ‚Der Triumph der Hoffnung über die Verzweiflung
Der Mann aus der Stadt. Der war auch nicht glücklich. In seinen Augen lag etwas so Finsteres, das mit ihren tiefsten Abgründen korrespondierte ... Roisin Maguire
Roisin Maguire: Mitternachtsschwimmer. DuMont Buchverlag, Köln 2024. Aus dem Englischen von Andrea O‘ Brian.
"Mitternachtsschwimmer", Debut der in Nordirland lebenden Roisin Maguire, hat offenbar ins Herz der LeserInnen getroffen. Zugleich ein Corona-Roman, spielt die hier erzählte Geschichte von einem traumatisierten Städter aus Belfast, Evan, der in einem idyllisch anmutenden Dorf an Irlands Küste gedenkt, eine Auszeit zu nehmen, doch zu Beginn des Ausbruchs der Pandemie. Eine Bleibe vermietet ihm die sich rau und spröde gebende Grace. Alleinlebend mit Hund, ganzjährig schwimmend, bestreitet sie ihren Lebensunterhalt u. a. damit, Zimmer zu vermieten und Quilts herzustellen, worin sie im Zuge der Erzählung unverhofft immensen Erfolg erzielt. Doch wie so oft verbirgt sich hinter ihrer rauen Schale eine tief verwundete Seele, was die beiden wiederum vereint.
Eine nicht unwesentliche Rolle kommt dabei dem Schauplatz zu, sprich das Meer und die Natur rings um das Dorf Ballybrady und deren heilsame Wirkkraft, die ein Gegengewicht zu den konfliktiv gezeichneten Charakteren bilden. Letztere wiederum erweisen sich vielfach als überaus farbige, eigenwillige, mit warmherzigem Humor gezeichnete Figuren, was den Reiz dieses Romans überdies ausmacht. So etwa Becky, die nicht nur einen kleinen Dorfladen betreibt, sondern, dem Buddhismus nahestehend, für ihre Kunden immer ein Wort weisen Trostes auf den Lippen hat. Und da ist Abbie, Nichte, zugleich Vertraute von Grace, die während des Lockdowns nicht nur vor ihren ungeliebten Kommilitonen zu ihrer Tante aufs Land flüchtet, sondern auch, um ihrer übergriffigen verwitweten Mutter, mit der es nur Zoff gibt, zu entkommen. Nicht zu vergessen, all die Gestrandeten rund um das Pub, dem Alkohol frönend, sich aber im Zweifelsfall als verlässliche Kumpels erweisend.
Und während Evan, nach dem Tod seiner kleinen Tochter Jessie verzweifelt und verstört, darum ringt, wieder ins Leben zurückzufinden, reißt diese exponierte psychische Konstellation auch bei Grace, die überdies mit dem Älterwerden hadert, alte Wunden auf. Der Lockdown wiederum sorgt dafür, dass die beiden gezwungen sind, sich mit all dem, was ihr Leben überschattet hat, auseinanderzusetzen. Hinzu gesellt sich Luca, Evans im Zuge besagten Familiendramas vernachlässigter achtjähriger Sohn, überdies taubstumm, da seine Mutter, ‚systemrelevant‘, rund um die Uhr eingespannt ist. Luca tut die Umgebung des Meeres zwar sichtlich wohl, was die konfliktive Beziehung zwischen Vater und Sohn jedoch nicht zu lindern vermag. Umso hilfreicher tritt hier Grace auf den Plan, die es versteht, mit dem sensiblen, naturverbundenen, zugleich einsamen Kind umzugehen – eines der berührendsten Momente in diesem Roman. Wie Maguire es überhaupt versteht, den Leser mit ihren vom Schicksal gebeutelten Figuren in den Bann zu ziehen, Empathie zu wecken.
*Interview mit Nora Tomaschoff, https://www.dumont-buchverlag.de/beitrag/interview-mit-der-autorin-roisin-maguire-b-54
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem DuMont Buchverlag
Buchtipp Juli - August 2024

© Hartmut Fanger
Cuthbert –Ein historischer Roman
Zeitlinienverschiebung zwischen Frühmittelalter und Moderne, Diesseits und Jenseits
Benjamin Myers: Cuddy. Echo der Zeit, Dumont Buchverlag, Köln 2024. Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence
Rechtzeitig zum Sommer erscheint mit Cuddy. Echo der Zeit der neue Roman von dem mehrfach mit Preisen ausgezeichneten Bestsellerautor Benjamin Myers. Nach dem beachtlichen Erfolg von „Offene See“ nun ein Historienroman erster Güte.
Dabei kommt die auf über 500 Seiten umfassende weitgehend fiktiv erzählte Geschichte des inoffiziellen englischen Schutzheiligen Cuthbert (um 635-687 n. Chr.), allgemein ‚liebevoll Cuddy genannt‘, über Jahrhunderte hinweg bis in die heutige Zeit hinein zur Sprache.
Ein wahrlich großer Roman, der es versteht, den Leser zunächst in eine mittelalterliche Welt zu entführen, existentielle Nöte der teils historischen Figuren nahezubringen, denen es oft genug tagtäglich allein ums nackte Überleben geht in einem von Hunger, Elend, Leid, Gewalt und von Seuchen geprägten Umfeld. Nichtsdestotrotz überwiegen der Glaube an Gott und die einzigartige Verehrung für den Heiligen. Eine Vielzahl von Zitaten diverser Zeitzeugen, sprich Mönchen, darüber hinaus Kirchenvertretern, Autoren aus dem18. Jahrhundert, wie der von Goethe verehrte Sir Walter Scott oder der Romantiker Schelling, sowie von Wissenschaftlern aus der Gegenwart, verleihen dem Ganzen seinen realhistorischen Hintergrund.
Hinzu kommen die vielen Geschichten und Sagen, die sich rundum Cuddy gesponnen haben. So wird zum Beispiel davon berichtet, dass er die Gewohnheit hatte, sich in der Nacht ins Meer zu begeben, um darin zu beten und um Gott nahe zu sein. Erst bei Sonnenaufgang hätte er das Wasser wieder verlassen. An einem denkwürdigen Tag sei er dann von zwei Ottern gewärmt worden. Im darauf folgenden Kapitel wird Cuddy gefragt, ob das mit den Ottern stimme. Er selbst sei die Antwort jedoch schuldig geblieben.
Darüber hinaus wird deutlich, mit welch grausamer Härte die Wikinger aus Dänemark – nicht umsonst als ‚die teuflischen Dänen’ bezeichnet – im Jahre 793 n.Chr. die heilige Insel Lindisfarne überfielen, dort nahezu jedes Leben zerstörten, raubten, plünderten und mordeten. Wie gut, dass einige Glaubensbrüder dem letzten Wunsch von Cuddy entsprochen und mit seinem Leichnam samt den heiligen Sakramenten rechtzeitig die Insel verlassen hatten.
Von Reiz in dieser ausschließlich Männern vorbehaltenen klerikalen Gruppierung ist, wenn ausgerechnet einer Frau es zukommt, darin eine wesentliche Rolle zu spielen. Ediva, die von ihrem gewalttätigen Ehemann unterdrückte junge Frau schließt sich zunächst den Mönchen an, bekocht und versorgt sie mit Heilmitteln. Doch Ediva ist es auch, die auf dieser jahrelangen Reise immer wieder Visionen von einem von Wasser umgebenen großen Berg hat. Und genau diese Visionen führen die Mönche samt Sarg mit dem Leichnam in das heutige Durham, wo Cuddy zu Ehren die große Kathedrale erbaut wird, wo er seine letzte Ruhestätte finden soll.
Vom Aufbau her innovativ die Perspektivierung. So, wenn sich etwa der längst verstorbene Cuddy mit seinen ihm ehrfurchtsvoll ergebenen Mönchen unterhält. Eine so gelungene wie ungemein kreative Auseinandersetzung des Autors mit dem Stoff, der den Leser von Beginn an bis zum Schluss in Schach hält.
Hervorzuheben ist nicht zuletzt die großzügige Gestaltung des Layouts, die dem Leser insbesondere im ersten von insgesamt fünf Büchern Freiräume zum Nachdenken und Meditieren gewährt. Manchmal enthält eine Zeile wie bei einem Gedicht nur ein einziges Wort. Oder aber es vermittelt sich der Inhalt eines Wortes mit dem äußeren Erscheinungsbild, indem zum Beispiel die Buchstaben des Wortes ‚Tiefe’ jeweils einzeln untereinander angeführt werden. Treffend dagegen die Geschichte im zweiten Buch von der Erbauung der Kathedrale, der Arbeit der Steinmetze, ausschließlich im üblichen Blocksatz. Darüber hinaus integriert der Autor weitere Genrespielarten, wie die Gestaltung von Szenen in Form eines Theaterstücks oder die Briefform aus dem 19. Jahrhundert. So geht zum Beispiel aus dem Schreiben des ‚Präbendars des sechsten Chorgestühls in der Kathedrale von Durham, Reverend William Nicholas Parnell, Mag. Theol, an Professor Fawcett-Black’ vom 5. Mai 1827 hervor, dass der Leichnam Cuddys nicht wie allgemein angenommen „tausendeinhundertvierzig Jahre nach seinem Tod, A. D. 687“ unversehrt geblieben sei, die Gebeine deshalb exhumiert werden sollen. Eine weitere spannende Geschichte bahnt sich an ...
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Dumont Buchverlag
Buchtipp Juli 2024

© erf
Innenraum Signaturen
Durch die Anwesenheit einer anderen inneren Erfahrung wurde ich aufmerksam auf die Überschreitung. Marica Bodrožić*
Barbara Rossi und Barbara Schleth: Ich liebe die Tage. Lyrische Prosa. Edition Maya, Heimbachtal 2024
Was verbindet das Autorinnen-Duo Barbara Rossi und Barbara Schleth in dem hier gemeinsam vorgelegten Band Ich liebe die Tage in fünf Kapiteln: „1 Tage im Faltenwurf“, “2 Was ich liebe“, „3 Familiengeflecht“, „4 Tränendes Herz“ und „5 Blassblaue Versprechen“. Ins Auge fällt zunächst die innere Resonanz, die ähnliche Frequenz, in der ihre Texturen, die sie thematisch wechselseitig bespielen, schwingen. Im Außen sind sie, über ihre Verbundenheit hinaus zu „eXperimenta. Magazin für Literatur, Kunst und Gesellschaft“ – Rossi als Redakteurin, Schleth mit Beiträgen dort vertreten –, erfahrene Navigierende in Sachen Sprache und Bildende Kunst, was sich in diversen Veröffentlichungen und Projekten niedergeschlagen hat. Nicht zuletzt dürfte sich dieser ihren Texten zugrunde liegenden Konstellation die darin zutage tretende erweiterte Perspektive verdanken – Momente der Überschreitung herkömmlicher Ordnung und Verortungen.
So streifen wir mit Rossi durch „Kleine Fluchten“. Musik hören. Stundenlang. Kopfhörer auf, Lautstärke hoch. Liedern für die Ewigkeit lauschen oder Liedern für eine Saison. Lieder jeden Genres. Von der Romantik bis zum ‚knurrenden Gesang der Death Metal Bands‘.
Bei Schleth ist es ein „Weicher Blick“ auf eine Szene im Herbst. Wenn Laub unter den Füßen raschelt, die Kastanie in die Manteltasche wandert, der Tag eingesammelt wird, am Ende „Dankbarkeit ein Mantel/aus Stille und Grün“ Leseprobe bleibt.
In „2 Was ich liebe“ verweist Rossis „Für wen auch immer“ auf die Ambivalenz, um nicht zu sagen, Unmöglichkeit der Liebe, solange die Beteiligten vom anderen ‚was auch immer‘ erwarten, Wünsche an ihn herantragen. „Lass mich frei, wenn du nicht kannst. Lass mir dir sagen, es tut mir leid. Lass mich nicht alleine ... Lass es mich beenden. Lass mich alles vermissen und nichts bereuen. Lass uns von vorne beginnen“. Leseprobe Man braucht sich gleichermaßen, wie man sich verbraucht.
Das nicht selten schmerzhafte Verhältnis zur Mutter kommt in Schleths „Tochter“ in vielschichtigen Bildern zur Sprache. Letztere, „der Zucht/und Ordnung/entkommen“ Leseprobe, ‚taucht erst spät‘ „unter das/Schweigen/gefrorener/Zettel“ Leseprobe, wo sie „Die Angst/der Mutter/Enttäuschung/Flucht und/Schmerz“ Leseprobe findet, ebenso wie „Ganz unten/... klein und verloren/ihr tapferes Muschelherz/ ...“ Leseprobe
Ein Höhepunkt „Legacy“ – wie schwer kommt der deutsche Begriff „Vermächtnis“ daher. Hier treibt Rossi die Überlagerung nicht greifbarer Dimensionen auf die Spitze und erzielt eine rational nicht nachvollziehbare Transzendenz, in der sich die Konturen der Form auflösen, Wahrnehmung in Schwingung gerät. Gewidmet Rossis Sohn Vincent – ‚dem Siegenden‘ –, ‚weiß‘ das lyrische Ich „dein reiches Leben blüht in meiner Lunge –/und reden wir von der Witterung/die am Körper abperlt/aber Spuren hinterlässt –/und reden wir von den Landschaftskarten –/ein Meer von Lichtern/und ein ozeantiefer Schrei –/und reden wir weiter von dem was war und ist/dann reden wir vom Anderssein/das uns berührt und verwandelt hat“ Leseprobe
Utopisch & licht mutet Schleths „Was wäre wenn“ an, wenn etwa „ein Stern/vom Himmel fiele/das Kind in uns/gefragt würde/Die Liebenden/sich mehr umarmten/ein Harfenton/durch die Nacht klänge/“ ... “Was wäre dann“ Leseprobe
Unsere Empfehlung: Gleiten Sie mit dem nicht zuletzt auch vom Cover her ansprechenden Band und seiner Fülle an poetischer Inspiration, Gedanken und Geistesblitzen durch die Tage ...
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt Edition Maya
* Marica Bodrožić: Die Rebellion der Liebenden, btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München 2024
Buchtipp Juni und Juli 2024

© erf
Literatur als Weg der Selbstfindung
Theodora Bauer: Glühen, Rowohlt, Berlin 2024
Nach dem Debut „Das Fell der Tante Meri“ und „Chikago“ der inzwischen vierunddreißigjährigen Wienerin und Erfolgsautorin Theodora Bauer folgt nun also „Glühen“, eine Spurensuche auf 123 Seiten, zugleich unverhoffte Liebesgeschichte. Ein Roman, der von Sinndefizit und Leere menschlicher Existenz in apokalyptisch anmutenden Zeiten kündet, erzählt in lakonischer Distanz.
Wenn ein Leben aus dem Gleichgewicht gerät, gilt es etwas zu ändern. Für Protagonistin ‚Lima’ steht fest, dass sie dringend eine Auszeit benötigt. Als Geisteswissenschaftlerin mit Schwerpunkt weibliches Begehren bei Arthur Schnitzler beschäftigt sie sich nahezu ausschließlichen mit dem Medium Text. Unentwegt liest sie. Bücher, literarische und wissenschaftliche Abhandlungen. Selbst publiziert sie Beiträge für Fachzeitschriften. Um das universitäre Umfeld für zwei Wochen hinter sich zu lassen, bietet sich eine „Sommerfrische“ in den Bergen an. Tief in ihr der Wunsch, dem abstrakt vertexteten Dasein etwas entgegenzusetzen, wieder pulsierende Lebendigkeit außerhalb des vergeistigten Alltags zu spüren. Ganz Frau sein, sich verlieben, wieder einmal ‚glühen’.
Magisch mutet in diesem Kontext die Begegnung Limas mit dem Senner vor Ort, Michael, an. In sinnfälligem Kontrast zum universitären Umfeld, aus dem sie kommt, der Strudel an Sehnsüchten, Begierden und erotischen Phantasien, in den sie gerät, und mit dem sie sonst allenfalls in den von ihr zu bearbeitenden Romanen in Berührung gekommen ist. Dabei scheint sich ein weibliches Begehren Bahn brechen zu wollen, frei von männlicher Zuschreibung. Denn Frauen, die ‚(auf)begehrten’, „wollten neben ihrem Begehren auch noch als Mensch existieren“. Zugleich vermischen sich dabei die Ebenen, sodass sich geistige und real erlebbare Welt nicht so einfach trennen lassen, auch Träume von Bedeutung sind. Dementsprechend kommt es immer wieder zu einer Auseinandersetzung der Protagonistin mit der vornehmlich von Männern verfassten Literatur und deren Sprachbegehren, sprich dem ihrem Wort beigemessenen Gewicht:
"Meistens gab es Worte, die zu viel wollten oder das Falsche, oder es gab zu wenig Worte. Die richtige Dosis von Worten nannte man Literatur. Davon gab es wenig. Es war eine hohe Kunst, die Menschen mit den Worten nicht zu vergiften oder sie verhungern zu lassen, an der ausgestreckten Hand, sie zu unterfüttern, ihnen den Stoff zum Denken zu nehmen oder sie darunter zu begraben, dass sie ganz dumm wurden. Sie mochte Literatur, weil sie ernsthaft bestrebt war, der Welt die richtige Menge an Worten zukommen zu lassen. Vielleicht beschäftigte sie sich mit Literatur, weil sie Rezepte, Anleitungen, Lösungen erkennen wollte." Leseprobe
Geschichte, Literatur und Philosophie lassen Lima nicht los. Und unschwer lässt sich Goethes „Faust“ erkennen, wenn der Protagonistin ein Pudel hinterherläuft, den sie verscheuchen will. Die Frage nach des Pudels Kern’ folgt auf den Fuß. Und nicht ohne Ironie vernehmen wir von seiner Besitzerin, der Wirtin, die Lima beherbergt, dass der Pudel ein Weibchen namens „Luzi“ sei. Es hält Lima den weißen Bauch hin, die der Aufforderung folgt und das Tier krault. Der Name Charona der Wirtin gemahnt wiederum an Charon, jenen Fährmann aus der griechischen Mythologie, der über den Fluss Styx ins Totenreich führt, was auf die Vielstimmigkeit des Romans verweist. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Liebesgeschichte zwischen Lima und Senner Michael, der iErzengel Michael nachempfunden sein mag, mystische Züge trägt, inwiefern der Topos ‚Liebe und Tod‘ hier mitschwingt, desgleichen Goethes ‚Stirb und Werde‘, wie der Schluss des Romans nahelegt:
"Es gab ein Zurück, aber dahin wollte sie nicht mehr. ... Sie würde sich langweilen in einem Leben. ... Lima fand eine kleine Kuhle. ... Sie ließ sich nieder und legte sich hin. ... So sollte ihre Geschichte enden, sie würde dieses Ende bestimmen ... Ein Aufbegehren, Feuergestalten, die jede Sekunde entstanden und vergingen. Ein ungleichmäßiger Rhythmus, ein Pulsieren der ganzen Welt. So viel Schönes, so viele Enttäuschungen. Ist es das alles wert gewesen, dachte sie, und habe ich am Ende doch etwas verstanden?" Leseprobe
Doch lesen Sie selbst den Text, lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt
Verlag

Buchtipp des Monats April/Mai/Juni 2024
© erf
Bilder des Schreckens in Schönheit gefasst
... ich habe es mit Gott und mit dem Teufel versucht, aber die Angst lachte. Das alles ging sie überhaupt nichts an. Sie stand auf irgendeinem ganz anderen Blatt, war nicht zu greifen mit dem Instrumentarium, das mir zur Verfügung stand. Sie war unverletzbar, resistent wie eine Hydra, der zwei Köpfe nachwuchsen, wenn man ihr einen abschlug.
Natascha Wodin in „Les Sables-d’Olonne“
Natascha Wodin: Der Fluss und das Meer. Erzählungen. Rowohlt Verlag. Hamburg 2024.
„Schönheit wird die Welt retten“ – dies als Präambel vorangestellte Dostojewski-Wort verweist auf die in den fünf hier präsentierten Erzählungen raffiniert arrangierte Liaison zwischen Schrecken und Schönheit. Ersteres manifestiert sich dabei eher inhaltlich, Letzteres wiederum erweist sich in einer dem diametral entgegengesetzten Ästhetik im sprachlichen Duktus.
Die 1945 in Fürth geborene Natascha Wodin war das Kind sowjetischer Zwangsarbeiter, die es aus Furcht vor der stalinistischen Repression nach Kriegsende nach Deutschland verschlagen hatte. Vor diesem Hintergrund entfaltete sich das Drama ihres Lebens, das letztlich nach eigenen Aussagen auch den Rohstoff ihrer Bücher abgibt.
Was alle fünf Erzählungen auf verstörende Weise verbindet, ist die Spur von Krieg, totalitärem Terror und Vertreibung im Zuge des 20. Jahrhunderts, die sich in gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen fortsetzt, um sich schließlich unheilvoll im Einzelschicksal der traumatisierten Protagonisten zu spiegeln.
So verarbeitet sie in der Titel gebenden ersten Erzählung „Der Fluss und das Meer“ nach ihrem Erfolg mit dem preisgekrönten Werk „Das Mädchen aus
Mariupol“ (2017) noch einmal den Selbstmord ihrer Mutter, die in Deutschland nie Fuß gefasst hatte. „Nachbarinnen“ ist die durchweg tragisch intonierte Geschichte einer so schicksalhaften wie
verhängnisvollen Spiegelung. In dem Maß, wie es der Ich-Erzählerin gelingt, aus unerträglich anmutender sozialer Enge auszubrechen und nach außen hin aufzusteigen, um sich in so genannten
geordneten Verhältnissen wiederzufinden, erlebt ihre Nachbarin einen unaufhaltsamen Niedergang erschütternden Ausmaßes, der schließlich in deren Tod mündet, während die Ich-Erzählerin sich wähnt,
daran mit Schuld zu tragen. „Notturno“ erhellt die Begegnung der Ich-Erzählerin mit dem schuldlos gestrauchelten, in einer Irrenanstalt internierten Heiner Fuchs, eines feinsinnigen Bruders im
Geiste, mit dem sie das Schicksal teilt, in der von der Naziideologie durchdrungenen Kleinstadt F. aufgewachsen zu sein, wo sie sich allerdings nie begegnet sind und zwischen denen sich eine
zarte Liebesgeschichte entspinnt. In „Das
Singen der Fische“ wiederum erfüllt sich für die Ich-Erzählerin nach dem Erhalt eines unverhofft hohen Honorars der Traum einer Fernreise nach Asien. Die Unternehmung avanciert allerdings, konfrontiert mit der dort vorherrschenden, unvorstellbaren Armut, zum Alptraum. „Les Sables-d’Olonne“ hingegen ist die so vielschichtige wie tiefgründige Erzählung einer Angststörung, aus der es kein Entrinnen zu geben scheint, worin zugleich facettenreich die höchst komplexe wie konfliktive Beziehung zwischen Psychoanalytiker und Klient reflektiert wird.
Jede der fünf Erzählungen scheint angetreten, Zeugnis zu geben, Zeugnis von den unzumutbaren existenziellen Gegebenheiten einer feindseligen Lebenswelt, die bei all den Versuchen, dem entgegenzuwirken, immer wieder zu Gewaltverhältnissen tendiert, sei es offen und brutal, wie es in Kriegen zutage tritt, sei es subtil, wie in der unbarmherzigen Mechanik des gesellschaftlichen Ganzen.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt
Verlag in Hamburg
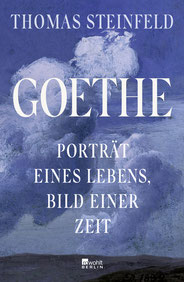
© Hartmut Fanger
Goethe – Biografie des Dichters und Universalgelehrten im Spiegel seines Zeitalters
Das Beste, was wir von der Geschichte haben,
ist der Enthusiasmus, den sie erregt.
Goethe in „Wilhelm Meisters Wanderjahre“
Thomas Steinfeld:: Goethe. Porträt eines Lebens, Bild einer Zeit. Rowohlt Verlag, Hamburg 2024.
Angesichts der Jahr für Jahr zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen über Leben und Werk Goethes insbesondere im asiatischen Raum mag so mancher ins Staunen geraten, wenn er dieses 784 Seiten umfassende, für einen breiten Leserkreis verfasste Porträt von Thomas Steinfeld in Händen hält. Leicht ist man versucht anzunehmen, auf diesem Gebiet sei bereits alles gesagt. Umso erstaunlicher, wenn der einstige Literaturchef der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», später Leiter des Feuilletons der «Süddeutschen Zeitung» und Professor für Kulturwissenschaften an der Universität Luzern neben allgemein Bekanntem so manches zu erzählen hat, was in der Forschung bislang, wenn überhaupt, nur wenig Beachtung fand. Etwa, dass ‚ein Naturalienkabinett‘ zur Ausstattung der Kinderstuben im entsprechend wohlhabenden, gebildeten Milieu gehörte – so auch von Kindheit an bei Goethe. Im Alter wiederum mündete dies in seine umfangreichen Sammlungen jeder Art von Steinen bis hin zur italienischen Majolika im Haus am Frauenplan. Aber auch seine Vorliebe für Spinoza, was annähernd einen Skandal in der damalig streng religiösen, sprich pietistisch geprägten christlichen Welt auslöste, kommt bei Steinfeld zur Sprache. Oder die Darstellung der einstig vorherrschenden Armut in Weimar, einem Ort, lediglich aus sechshundert Häusern bestehend, in dem man sich zwangsläufig begegnete, sich kaum ausweichen konnte. Ebenso wenig wie die von Steinfeld skizzierte Lebensgeschichte von Goethes Sohn August hier unerwähnt bleiben darf, die nicht zuletzt im Hinblick auf Goethe selbst sehr wohl von Bedeutung ist.
Ein Plus überdies der ungeschminkte Schreibstil Steinfelds, frei von Verklärung des universalgelehrten Dichters bei gleichzeitiger Hervorhebung seiner Genialität im poetischen Schaffen von Gedichten, Theaterstücken, Romanen und Märchen, Briefen und autobiographischen Texten – unvergänglich eingegangen in die Weltliteratur. Allesamt kommen sie hier mit jeweiligem Hintergrund ausführlich zum Tragen, so dass dies auch für künftige Schülergenerationen und Studierende sowie sonstige Interessierte von Nutzen sein wird. Von „Götz von Berlichingen“ bis hin zu den „Leiden des jungen Werther“, von “Wilhelm Meisters Lehrjahre“ und ‚Wanderjahre’ bis zu den „Wahlverwandtschaften“, vom „Westöstlichen Divan“ bis hin zu „Faust I“ und „Faust II“; nicht zu vergessen die naturwissenschaftlichen Schriften, wie etwa die „Farbenlehre“ oder „Entdeckung des Zwischenkieferknochens“.
Bereichernd im Übrigen die Einbringung des kulturell-gesellschaftspolitischen Umfelds. So bringt Steinfeld zum Beispiel ausführlich die Freundschaft des jungen Goethe zu Lavater und dessen Studien zur Physiognomie ins Spiel. Der wiederum war der Annahme, dass sich mit Hilfe eines Schattenrisses vom seitlichen Profil eines Menschen ‚Charakter, Denkweise, Gemüt’ ablesen lasse. Dies erklärt womöglich auch das besondere Interesse Goethes am Scherenschnitt. Demnach gab es in der Goethezeit im Hinblick auf das Menschenbild noch vieles zu entdecken, was dann auch das Aufkommen der neuen literarischen Form des Briefeschreibens erklärt. Bei Goethe steht am Ende der Briefroman, sprich „Werther“. Auch erfahren wir im Zuge dessen, dass der Roman wenig Renommee besaß, vielmehr als «Genre der Unterschichten» [galt] und allgemein im Verdacht stand, „Vernunft, Sittlichkeit und Kunstsinn der Bürger zu untergraben.“ Leseprobe. So mag sich der große Erfolg von ‚Werther‘, der damalige Verkaufszahlen sprengte und selbst Napoleon begeisterte, nicht zuletzt dem hohen Identifikationsgrad der Leserschaft mit dessen Schicksal verdanken. Napoleon hatte später auf seinen Eroberungsfeldzügen Goethe deshalb sogar in Erfurt getroffen.
Bereits hier mag sich das im Untertitel erwähnte, von Umbrüchen geprägte „Bild einer Zeit“ andeuten, was Goethe immer wieder existenziell erschüttert hat. So beginnt Steinfelds Werk auch mit dem „September 1792“, jenem ‚vierten Herbst nach Beginn der Französischen Revolution’, wo Goethe ‚widerwillig in den Krieg ziehen’ musste und deutlich wird, dass der Dichter wahrlich nicht zu kämpfen gewillt war. Zugleich zeigt Steinfeld auf, dass der einzige Kampf, den Goethe ausfocht, jener gegen Isaac Newton im Hinblick auf seine „Farbenlehre“ war, der allerdings allein schon insofern auf rein intellektueller Ebene ausgetragen wurde, werden konnte, als dieser schon ein Jahrhundert vor ihm gelebt hatte.
So ungeschminkt wie plastisch schildert Steinfeld auch jene Orte, in denen der Dichter und Geheimrat wirkte. Darunter natürlich die Kindheit in Frankfurt am Main, das Studium in Leipzig und Straßburg, die Umsiedelung nach Weimar sowie die Reisen nach Italien, in die Schweiz oder auf den Brocken im Harz. Aber auch die zahlreichen Besuche von Kurorten, wie zum Beispiel Karlsbad oder Teplitz in Böhmen, finden Erwähnung. Immerhin eröffneten sie ihm Bekanntschaften mit dem Hochadel, wie mit der österreichischen Kaiserin Maria Ludovica, oder Musikern, wie Beethoven.
Anders als die Biographie von Rüdiger Safranski („Goethe – Kunstwerk des Lebens“ 2013) wird hier Goethes Leben nicht mit dessen Kunst gleichgesetzt, wie am Schluss deutlich zutage tretend. So etwa, wenn – entgegen seinem Werk von überragender literarischer Qualität sowie dem hohen gesellschaftlichen Ansehen – von Goethe bekannt ist, dass er im Alter zu „Missmut, Bitterkeit, Resignation“ neigte, ja sogar von teils „selbstgewählter Isolation“ die Rede ist, was Goethe wiederum eher wohltuend menschlich in Erscheinung treten lassen mag.
Sicher gäbe es jede Menge weiterer Punkte zu berücksichtigen, ist das Leben Goethes im Spiegel seiner Zeit doch einfach zu komplex, um jeden einzelnen Aspekt auszuführen. Umso mehr ist das vorliegende Werk Steinfelds angetan, dem Ganzen sehr wohl gerecht zu werden und auf den Punkt genau die Lebensstationen Goethes, dessen Schaffensprozess und Werk sowie die in all ihren Facetten geschichtsträchtige Zeit vor Augen zu führen. In jedem Fall lesenswert, nicht nur für Goethekenner, sondern auch für all jene, die gerne lesen und mehr von Goethe und dessen Umfeld erfahren wollen.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt Verlag, Berlin
Buchtipp des Monats März 2024

© Hartmut Fanger
Im Zauberland der Fantasie
Haruki Murakami:
Die Stadt und ihre ungewisse Mauer
DuMont Buchverlag, Köln 2024, aus dem Japanischen von Ursula Gräfe
Rechtzeitig zum 75. Geburtstag Haruki Murakamis hat sich der Bestseller-Autor aus Japan mit dem 672 Seiten umfassenden Roman „Die Stadt und ihre ungewisse Mauer“ selbst ein Geschenk gemacht. Zugleich Ergebnis der pandemiebedingten Zeit der Isolation während des Lockdowns.
Dabei fußt das Ganze auf der gleichnamigen, 100 Seiten umfassenden Kurzgeschichte von 1980, die 1985 in seinem Roman „Hardboiled Wonderland“ schon einmal wiederverwendet wurde und womit er, wie dem Nachwort zu diesem jüngsten Werk zu entnehmen, wohl nie ganz zufrieden gewesen war. Nun wird es seinen Ansprüchen gerecht.
Wie bereits in vorherigen Romanen changiert bei Murakami auch hier die Wirklichkeit beständig mit dem Reich der Fantasie. Auf der Basis einer zarten Liebesgeschichte zwischen einem siebzehnjährigen namenlosen Ich-Erzähler und einem jungen Mädchen entsteht eine spannende, geheimnisvoll und mysteriös anmutende Geschichte, die den Leser mit dem Verschwinden des Mädchens in der erträumten Stadt von Beginn an packt und deren wunderbarer Erzählfluss ihn bis zum Schluss hin nicht mehr loslässt. Einen Großteil dazu mag hier auch die Übersetzung der mehrfach ausgezeichneten Ursula Gräfe beigetragen haben.
Dementsprechend gern lässt sich der Leser in die Welt Murakamis entführen, in besagte fiktionale Traumwelt, in der u.a. von Einhörnern, einer Uhr ohne Zeiger, einer Bibliothek ohne Bücher und einer sprechenden Mauer die Rede ist. In eine Stadt, in der es zu allem hin weder einen Schatten noch so etwas wie Leid oder Trauer gibt. Von fehlenden Energieträgern wie Gas oder Strom ganz zu schweigen. Von Musik gar nicht erst zu reden. Für den Ich-Erzähler wiederum insofern eine schmerzliche Erfahrung, als er das Mädchen in der Stadt zwar wiederfindet, diese ihn jedoch nicht mehr erkennt.
Am Ende entscheidet der Namenlose, dass er ohne seinen Schatten nicht weiterleben kann, und verlässt fluchtartig die strengbewachte Stadt, wobei zugleich jedoch etliche Gefahren auf ihn lauern. Zurück in der realen Welt, wird der inzwischen über Vierzigjährige in den Bergen Fukushimas Bibliotheksdirektor. Allein die Erinnerung an seine Liebe zu dem Mädchen bleibt erhalten.
Nicht nur für Murakami-Fans, sondern für alle, die sich für Fantasy interessieren oder sich zeitweise aus der rauen Realität ins Reich der Phantasie begeben wollen, eine inspirierende Lektüre, von Melodiösität und Bildgehalt der Sprache her auf höchstem Niveau. Von der ‚Magie des Erzähltons’ wiederum spricht Iris Radisch und schreibt dieser „absolute Simplizität mit dem großen Anspruch einer Wiederverzauberung des Alltags“ zu.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem DuMont Buchverlag in Köln
Buchtipp des Monats März 2024

© erf
Altersbilder im Gegenlicht
Wenn sie daran dachte, Miffy zu fragen, ob sie ihre Hand halten könne, schämte sie sich plötzlich für ihren missgestalteten, hässlichen Körper. Das sind die Risiken von Liebe und Lust; besser, nichts zu fühlen, aber dafür war es bei Susan nun zu spät. Das Feuer war entfacht.
Jane Campbell in „Susan und Miffy“
Jane Campbell: Kleine Kratzer. Storys. Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell. Kjona Verlag, München 2023.
Das im Feuilleton gefeierte Debüt Jane Campbells (*1942), 2022 in Großbritannien erschienen, im Sommer 2023 in deutscher Übersetzung, bietet 13 stilistisch brillante Storys über 13 markante Heldinnen – allesamt alte Frauen. Bevor sich Campbell ihren schriftstellerischen Aktivitäten widmete, wirkte sie in Oxford als Psychoanalytikerin, wo sie auch heute noch die Hälfte des Jahres lebt, die andere Hälfe verbringt sie auf den Bermudas.
Spiegeln die Storys einerseits generell die unbarmherzigen Rahmenbedingungen wider, denen Individuen in einer Welt ausgesetzt sind, in der nahezu jeder Lebensbereich von der Effizienz kommerzieller Priorisierung dominiert wird, erweisen sich diese, kommen altersbedingte Einschränkungen hinzu, als ausweglos anmutende Aporien. Die Lösung, die moderne Gesellschaften für Herausforderungen dieser Art gefunden haben, besteht in der Ghettoisierung, sprich der Unterbringung in dafür vorgesehenen Einrichtungen. Unterkunft für so viele auf der letzten Lebensstation, um die sich niemand mehr kümmern kann.
Den Zumutungen des Alters mit seinen Verlusterfahrungen, unwiederbringlichen Erinnerungen oder körperlichen Gebrechen entrinnen auch Campbells Protagonistinnen nicht. Was sie von gängigen Bildern ihrer Generation unterscheidet, ist, dass sie keinem der von ihnen grassierenden Klischee entsprechen. Der Lebendigkeit in ihrem inneren Erleben tut auch das Alter keinen Abbruch. Hier lassen sie sich keine Schranken auferlegen, überschreiten die ihnen auferlegten Grenzen und brechen Tabus. So etwa, wenn die stets in bürgerlichen Grenzen sich bewegende, totkranke Susan ihrem so zarten wie zärtlichen erotischen Verlangen gegenüber ihrer jungen Pflegerin Miffy nachgibt und es zu einer magisch und im wahrsten Sinne des Wortes „Wunder voll“ anmutenden sexuellen Begegnung zwischen den beiden Frauen kommt. Aber auch genüsslich und lustvoll bösartig agieren sie, wie in „Edelmut“, wo die Ich-Erzählerin „gutbetuchte Pensionäre“Leseprobe aufs Korn nimmt, die in ‚einer kleinen Stadt an der Westküste Englands Zuflucht gefunden haben‘. Beim Laufen trifft sie jeden Morgen auf Leo, einst erfolgreicher Chirurg, Ende siebzig, gutaussehend, aber „ein Scheißkerl“, der sich einen Hund angeschafft hat, Brutus, der diesem Namen alle Ehre macht und nicht nur riesig, sondern überdiese bissig ist. An Leos Seite die ihm ergebene „Mattie, klein, dick und dumm“ Leseprobe, die sich vor diesem Hund fürchtet. Die Ich-Erzählerin wird Mattie mit kaltblütigem Kalkül von beiden erlösen. Endgültig. Gnadenlos.
Zwischen Einsamkeit und einem Begehren, das sich jeder gesellschaftlichen Norm entzieht, bahnen sich die 13 Heldinnen ihre ganz eigene letzte Wegstrecke, sehen dabei Demenz und Hinfälligkeit ins Auge. Sie lassen es sich nicht nehmen, an alte Lieben anzuknüpfen, auch wenn der Faden, der sie noch verbindet, ausgedünnt scheint, um dann auf poetisch anmutende Weise in „der weiten Wasserebene des Sambesi“ zu verschwinden. Die bei dieser Lektüre aufgerufenen, mitreißenden inneren Bilder wiederum gemahnen an John Everett Millais‘ Gemälde der tot im Fluss treibenden „Ophelia“ (1851-1852).
Campbells Heldinnen sehen sich dabei zu, wie die Demenz ihr Gedächtnis sabotiert und gehen zugleich verstörenden erotischen Fantasien nach, optieren für Freitod. Doch wie auch immer sie sich auf dieser letzten Wegstrecke bewegen, verstehen sie es auf ihre ganz eigene, unerwartete Weise, sich der für sie vorgesehenen Verwahrung und Verwaltung zu entziehen. Und sie tun das mal mit Witz, mal mit dem gebotenen Sarkasmus, mal gnadenlos und zärtlich, dabei stets ihren eigenen Vorstellungen und Fantasien folgend.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Kjona Verlag, München
Buchtipp des Monats Februar 2024

© erf
Im Herbst die Rückkehr nach Hamburg. Eine Trümmerstadt ... Die Mutter, der Vater lesen vor:
Geschichten aus Tausendundeine Nacht. Der magnetische Fels, an dem die Schiffe zerschellen.
Die Palastpforte, durch die der Sultan als Bettler geht. Der Bucklige. Die Gärten. Die
Rose. Das Wasser. Der Zauberer. Der Dichter. Der Handwerker.
Autor Zwischen Handwerk & Dichtung
Uwe Timm: Alle meine Geister, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023.
Eine Stadt in Trümmern, Hunger. Das waren die Ingredienzien der Nachkriegszeit. In Timms Kindheit – ein Glück! – angereichert durch das Vorlesen der Eltern von Märchen aus Tausendundeine Nacht. Ambivalente Ausgangsbasis, aber vielleicht gerade deshalb zugleich fruchtbarer Boden für die Genese eines Autors, der tief eingetaucht ist – nicht nur in den Stoff der Literaturen, sondern auch in das Handwerk des Schreibens, geschärft durch das zunächst erlernte Kürschner-Handwerk. War doch vorgesehen, dass er den Kürschner-Betrieb des Vaters übernimmt.
Mit fünfzehn Jahren tritt er die Lehre an. Bei „Modehaus Levermann“ am Jungfernstieg. Das stand für solide Extra-Klasse, verglichen mit dem bescheideneren „Pelze-Timm“, dem Familienunternehmen im Eppendorfer Weg. Timm selbst wäre lieber auf dem Gymnasium geblieben, wo er Freunde hatte. Aber eine Lese- und Rechtschreibschwäche veranlasst den Vater, ihn in einer Kürschner-Lehre unterzubringen. Dabei kommt ihm die dem Kürschner-Handwerk eigene Präzision nicht zuletzt beim Schreiben zugute. Denn Felle müssen sortiert und sorgfältig zusammengesetzt werden, sodass Nähte unsichtbar bleiben. Wie auch Wörter und Sätze ‚sorgfältig zusammengesetzt‘, Übergänge zwischen einzelnen Passagen geschaffen werden müssen.
Aber nicht nur insofern erweist sich die Tätigkeit im Kürschner-Betrieb als solide Vorarbeit für das Handwerk des Schreibens. Es lässt ihm im Zuge des Bearbeitens des Materials auch Raum, seinen Gedanken nachzuhängen, zu träumen. Im Übrigen sind es die markanten Persönlichkeiten, denen er dort begegnet und die einen prägenden Einfluss auf ihn haben. Diese und nicht zuletzt die Bücher, die sie ihm empfehlen, machen schließlich jene Titel gebenden ‚Geister‘ aus. Und Timm bringt sie dem Leser im wahrsten Sinne des Wortes nahe, dabei jedoch stets den gebotenen, der Diskretion geschuldeten Abstand wahrend.
Darunter etwa Kürschner-Meister Kruse, der als Linker im politischen Widerstand war und dem er seine politische Sozialisation verdankt. Oder Kollege Johnny-Look, mit dem er nicht nur Lektüren und die Vorliebe des Jazz teilt, sondern auch erste Erfahrungen in der Liebe – ein in seiner funkelnden Lebendigkeit unvergessliches Porträt.
Aber auch die teils außerordentlichen Begegnungen mit den Pelzträgerinnen, etwa der verarmten Adligen aus St. Petersburg, berühren. Es ist eigentlich nichts mehr zu machen, so alt und brüchig ist der Mantel, den sie zur Reparatur bringt. Allein, sie insistiert darauf. Und Timm erbarmt sich. Nimmt kein Geld dafür. Stattdessen lässt er sich bei ihr zum Tee einladen und hat Gelegenheit, von ihrem bewegenden Schicksal zu erfahren.
Allein schon deshalb ist Timms „Erinnerungsbuch“ zugleich als Kulturgeschichte des Kürschner-Handwerks und dessen Niedergang im Zuge von Billigprodukten aus Osteuropa und China zu lesen. Tragik, die am Ende die verwitwete Mutter trifft. Und statt nach glänzendem Abschluss der Lehre das Abitur nachzuholen, wie Timm es vorhatte, steht er dieser zur Seite und hilft ihr, den Handwerksbetrieb abzuwickeln, tut das mit Bravour. Da ist er gerade mal 18.
Das Abitur wird er entsprechend später nachholen. Auf dem Braunschweig-Kolleg, wo er mit Benno Ohnesorg zusammenkommt, Freundschaft mit ihm schließt. Weg, der ihm im Anschluss daran mit dem Studium der Philosophie und Germanistik in München und Paris die Tür zu seinem eigentlichen Traum, nämlich Schriftsteller zu werden, öffnet. Als solcher wird er ein Werk zum Besten geben, in dem ‚alle seine Geister‘ in der ihnen eigenen Poesie, Lebenskraft und Lebendigkeit wieder auferstehen.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Buchtipp des Monats Januar 2024
© Hartmut Fanger
Amerika, Österreich und der rest der Welt – Eín nicht ganz wertfreier Blick

Stefanie Sargnagel: Iowa. Ein Ausflug nach Amerika, Rowohlt Verlag, Hamburg 2024
In ihrem neusten Werk wirft die gebürtige Wienerin Stefanie Sargnagel in ihrer Funktion als Autorin und beauftragte Lehrerin für Kreatives Schreiben an der Uni in Iowa einen ungeschminkten Blick auf ein Stück Amerika, das uns das Fürchten lehrt. So etwa, wenn die Ich-Erzählerin Stefanie S. von Waffenbesitz, Obdachlosigkeit, der omnipräsenten Vorherrschaft des Autos und der dörflichen Enge von Grinnell in Iowa berichtet und dem Gefühl, ‚zwischen Beton und Wolken langsam zerquetscht zu werden’. Ganz zu schweigen von der schlechten Esskultur in den USA, gefolgt von Übergewichtigkeit so vieler im Lande sowie Alkoholismus.
Doch damit nicht genug. Einst ‚Land der unbegrenzten Möglichkeiten‘, scheint diese Verheißung indessen der Vergangenheit anzugehören. Sei es, wenn wir mit Stefanie S. in die ‚halbleeren Schaufenster’ der Mainstreet des Ortes blicken oder uns damit konfrontiert sehen, wie im Rahmen einer rechtsgerichteten Cancel Culture Bücher von Margaret Atwood oder der Nobelpreisträgerin Toni Morrison aus Bibliotheken reaktionärer Bundesstaaten verbannt werden. Bemerkenswert in diesem Kontext, dass Cancel Culture in Deutschland im Gegensatz zu den USA politisch eher von links kommt. Dabei spart Sargnagel nicht mit Informationen aus ihrer Heimat und schildert prekäre Verhältnisse insbesondere von Künstlern und Künstlerinnen Ü60 in Deutschland und Österreich. So etwa ihre Begleiterin Christiane, die davon als erfolgreiche Sängerin im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied singen kann und vom Alter her deren Mutter sein könnte. Die wahre Mutter von Stefanie S. lässt es sich allerdings nicht nehmen, diese in Grinnell zu besuchen – nachdem Christiane abgereist ist. Klar, dass Amerika von nun an über die Grenzen Iowas hinaus besichtigt werden will.
Erschütternd im Zuge dessen die Schilderung der Zustände in den Metropolen, die Stefanie S. mit ihrer Mutter bereist. So, wenn sich die „Glamour und Weltgewandtheit versprechende Stadt Los Angeles als eine Riesenobdachlosensiedlung“ (Leseprobe) entpuppt, San Francisco trotz des nahe gelegenen Silicon Valley und einem Bruttoinlandsprodukt von 3,6 Billiarden an der schieren Masse Obdachloser zu ersticken droht. Auf der anderen Seite des Kontinents wiederum heißt es von Chicago, dass dort ‚die Wolkenkratzer eher beruhigend wie das Meer’ seien. Zumindest wenn man vom offenbar selbstverständlichen Besitz von Waffen in Chicago absieht. So sei etwa keine der Freundinnen der Exildeutschen Simone – Stefanie S. kennt sie aus dem Internet und ist mit ihr in einem Underground Club verabredet – nicht schon einmal in eine Schießerei geraten.
Gewürzt bei allem Ernst der Lage mit Witz, Ironie und Humor, lesen sich die Ausführungen leicht und locker und unterhaltsam, ohne dass dies den hohen Informationswert schmälerte. Reizvoll überdies der spielerische Einsatz von Fußnoten, die dem Ganzen weitere Erkenntnisfacetten hinzufügen.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt Verlag in Hamburg
Buchtipp des Monats Dezember 2023-Januar 2024

© erf
Angst, Langeweile und leuchtende Leere
Ja, jetzt stehe ich hier, sitze ich hier, dachte ich, und ich fühlte mich leer, als ob die Langeweilezu Leere geworden wäre. Oder eher zu Beklemmung, denn ich fühlte eine Angst in mir,wie ich dasaß und vor mich hin schaute, leer, wie in einem Nichts drin. Jon Fosse
Jon Fosse: Ein Leuchten, Rowohlt Verlag, Hamburg 2023
Jon Fosses jüngster Roman, eine Art Meditation, ist zugleich als Allegorie lesbar für das Ringen des Menschen der Moderne mit seiner Existenz unter den Bedingungen metaphysischer Obdachlosigkeit. Abgekoppelt von der Religion, sprich von der Verbindung zu einer spirituellen Instanz (lat. religio, dt. Rückverbindung), scheint er tief in seinem Inneren auf verlorenem Posten. Sein Leben seit der Aufklärung nahezu ausschließlich nach Prinzipien bestehender Rationalität ausrichtend, beschleicht ihn Langeweile. Hinzu kommt ein Mangel an Verbundenheit, sei es mit der Natur, sei es im sozialen Umfeld. Die Folge – der Mensch der Moderne fühlt sich isoliert, begleitet von Angst und Beklemmung.
Eben dies ist der Ausgangspunkt der Ich-Stimme in Ein Leuchten, wo der Protagonist, aus Langeweile und Überdruss in den Wald fährt und aus diesem, willkürlich mal nach links, mal nach rechts abbiegend, nicht mehr herausfindet. Vergeblich hält er Ausschau nach einem Wendeplatz. Er steigt aus dem Wagen und dringt bei zunehmender Dunkelheit und Kälte immer tiefer in den Wald. Als es obendrein zu schneien beginnt, verliert er, indessen müde und hungrig, vollends die Orientierung, findet auch nicht mehr zu seinem Wagen zurück. Der Protagonist hadert mit sich. Das war bar jeder Vernunft. Es droht ihm die Gefahr zu erfrieren. Wie konnte er nur. Zurückgezogen lebend, würde ihn nicht einmal jemand vermissen.
Doch da sieht er mit einem Mal ein Leuchten, es scheint eine Gestalt zu sein, „wundersam schön anzusehen“ Leseprobe, die sich auf ihn zubewegt. Ist es ein Engel? Ein Gespenst? Als die Gestalt vor ihm steht, geht von dem Leuchten eine Wärme aus. Und dann hat es den Anschein, dass sich erst eine Hand, dann ein Arm um seine Schulter legt, so dass er sich gehalten fühlt, so vage wie zugleich untrennbar mit der Gestalt verbunden. Und er fragt, wer sie sei, und sie antwortet: „Ich bin, der ich bin ...“ Dies kommt dem Ich-Erzähler zwar bekannt vor, aber die Erinnerung an die biblische Geschichte von Moses, der diese Stimme aus dem brennenden Dornbusch gehört hat, scheint ihm fern.
Doch die Gestalt verschwindet mit einem Mal, so wie sie gekommen ist, wird aber auf mysteriöse Weise von einer Vision seiner Eltern abgelöst. Die Mutter tadelt ihn, er solle sich benehmen. Nörgelt an ihm herum, allein in den kalten Wald gegangen zu sein, wo er erfrieren könne. Als ob er noch ein Kind sei. Die Eltern sind alt geworden, dabei hat er sie doch erst gesehen. Vor etlichen Jahren? Oder waren es ein paar Monate, Wochen, Stunden? Wie diese Überlegungen bleibt auch alles andere im Ungewissen, Ungefähren. Protagonist wie Leser sind auf sich selbst zurückgeworfen. Rationale Erwägungen greifen nicht mehr. Damit wird ein Feld eröffnet, in dem die physikalischen Gesetze des materiellen Raums von einer nicht greifbaren metaphysischen Sphäre abgelöst werden, die so etwas wie Trost verheißt. Was im Übrigen auch der Schluss nahelegt – zum einen als Todesvision lesbar, zugleich aber auch als Mahnung, dass der Mensch, getrennt von jeglichem Bewusstsein der Transzendenz, Gefahr läuft, der Verbundenheit zu seiner Seele und damit zur Schöpfung überhaupt wie zu seiner Mitmenschlichkeit verlustig zu gehen.
„ ... und dann bin ich plötzlich in einem Licht drin, so stark, dass es kein Licht ist ... sondern eine Leere, ein Nichts ... und plötzlich gibt es keinen einzigen Atemzug mehr, nur noch die glänzende, schimmernde Gestalt, die in einem atmenden Nichts leuchtet, das jetzt wir atmen, von ihrem Leuchten.“ Leseprobe
Damit tauchen wir tief in die Sphären des Ungewissen, das wir nicht greifen können und das uns doch stets umgibt, man könnte auch sagen –in das Geheimnis des Lebens schlechthin.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt Verlag,
Hamburg
Buchtipp des Monats Dezember 2023

© Hartmut Fanger
Ein Leben für Bücher und ihre Autoren
Michael Krüger: Verabredung mit Dichtern Erinnerungen und Begegnungen
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2023
Zu seinem 80. Geburtstag erzählt Michael Krüger, einstiger Verleger des Hanser-Verlages in München, aus seinem Leben. Dabei scheint es ihm unmöglich, das Ganze in einen ‚erzählbaren Ablauf‘ zu bringen, ist im Rückblick doch alles ungewiss, vieles wiederum verschwimmt. Und hat er von dem einen oder anderen Geschehnis ein klares Bild vor Augen, fällt es ihm schwer, es in Worte zu fassen. Doch bei all dieser selbstkritischen Einschätzung bietet das Buch einen lebensprallen Einblick in die außergewöhnliche Vita des großen Verlegers.
So erfahren wir von der trotz Krieg behüteten Kindheit bei seinen tief religiösen Großeltern auf dem Land in Sachsen-Anhalt, die ihm beim Erzählen der biblischen Geschichten die Liebe zur Literatur sozusagen ‚in die Wiege gelegt haben‘, bilden die Geschichten der Bibel doch den Grundstein der abendländischen Literatur schlechthin. Ein großes Stück Historie wird dann im Zuge der Schilderung seines Heranwachsens in der geteilten Stadt Berlin transparent. Dass Michael Krüger nicht, wie einst von ihm favorisiert, Landwirt oder Förster geworden ist, sondern sich für eine Verlagslehre in der Verlagsbuchhandlung Herbig (Berlin) entschied, ist wiederum ein Glück, sowohl für die Verlagswelt als auch die Leserschaft.
So werden wir Zeugen eines beachtlichen Werdegangs, wobei er Einblick in die Verlagswelt wie u.a. besagten Carl Hanser Verlag gewährt. Darüber hinaus säumen seinen Weg berühmte Verlegernamen wie Klaus Wagenbach oder wegweisende Figuren und namhafte Autoren nach dem Zweiten Weltkrieg, Mitglieder der Gruppe 47, wie etwa Walter Höllerer, und geben entscheidende Impulse. Überdies findet sich im Zuge all dieser Begegnungen jede Menge Zeitkolorit. So, wenn er sich an die sechziger und siebziger Jahre erinnert, an jenen Aufbruch, der 1968 seinen Lauf nahm, gefolgt von den bald insbesondere von Reinhard Lettau und Klaus Wagenbach mit angestoßenen Anti-Vietnam-Demonstrationen. In den Siebzigern vor allem die von Adam Zagajewski unterstützte Solidarność-Bewegung in Polen.
Einen Schwerpunkt bilden nicht zuletzt die zahlreichen weltweiten Freundschaften mit namhaften Figuren der damaligen literarischen Szene, sei es in Italien, Schweden oder Polen – Italo Calvino, Lars Gustafsson, Adam Zagajewski, um nur einige zu nennen. Und dann sind da natürlich noch die literarischen Meisterwerke, wie etwa die in den 90ern erschienen holländischen Romane von Harry Mulisch mit „Die Entdeckung des Himmels« oder »Die Gesetze« von Connie Palmen, »Erst grau, dann weiß, dann blau« von Margriet de Moor oder »Die folgende Geschichte« von Cees Nooteboom.
Doch auch am literarischen Glanz und Glamour inspirierender Metropolen wie etwa London haben wir als Leser teil, wo Michael Krüger in jungen Jahren dank Alastaire Hamilton, Sohn des Verlegers Hamish Hamilton, leben und im legendären Harrods arbeiten konnte und maßgeblich den Aufbau des International Book Departments vorantrieb. „Nicht Paris, nicht Rom oder gar Berlin war das Zentrum der Welt, sondern London, und Harrods war gewissermaßen das Herz des damals immer noch großen British Empire.“ Leseprobe
Aber auch Lindos auf Rhodos erweist sich als Lebensstation, wo sich Michael Krüger in einem Haus von Gregor von Rezzori zurückzieht und der Musik seines dortigen Nachbarn, David Gilmour von Pink Floyd, lauscht.
Verfolgt man all die Stationen, forscht man all jenen erwähnten Dichtern und Büchern nach, so stößt man unweigerlich auf den Gedanken, dass es sich bei dem vorliegenden Werk um ein Mammutprojekt handelt, das womöglich einer Fortsetzung bedarf. Und tatsächlich heißt es am Schluss, dass es noch so vieles zu berichten gebe. So fehlten die Schweizer Autoren ebenso wie man die Franzosen, Spanier, Portugiesen vergeblich suche. Weder finde man Dichter aus dem Baltikum oder aus Russland, aus der Ukraine, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, kein Grieche, kein Türke, von japanischen Dichtern oder chinesischen ganz zu schweigen.
All dies soll in einem weiteren Band folgen. „Es bleibt also noch viel zu tun“, heißt es. Und wir dürfen gespannt darauf sein.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2023
Buchtipp des Monats November 2023

Mein ganzes Leben lang hat mir meine Mutter weisgemacht, dass es ihr schlecht ging. Drei Tage
vor ihrem Tod kam sie mit der Neuigkeit daher, dass es ihr gut ging. Es mussteein Irrtum vorliegen. Wir waren die, denen es schlecht ging. Wolf Haas
© erf: Requiem auf eine Mutter
Wolf Haas: Eigentum, Carl Hanser Verlag, München 2023.
Der Tod der eigenen Mutter macht etwas mit einem. Wie Wolf Haas ihn hier literarisch verarbeitet, macht wiederum etwas mit dem Leser. Den inneren Aufruhr angesichts eines solchen Abschieds für immer versteht er so fantasievoll wie facettenreich, vor allem aber vibrierend lebendig nahezubringen. Ein Vakuum zwischen Trauer und Fassungslosigkeit. Erzählerischer Tiefgang, der zugleich so lächerlich wie skurril anmutet. ‚Ein Leben im Mangel‘ ist mit diesem Tod zu Ende gegangen, geprägt von Mühen, Nöten und finanziellen Engpässen. Der Titel des Romans, Eigentum, bildet die Leerstelle im Leben dieser Mutter, um die sich alles dreht. Kurz davor, ein solches in Form einer Immobilie zu erwerben, kommt die Inflation. Da heißt es „nichts wie sparen, sparen, sparen“. Aus die Maus mit dem Traum vom eigenen Grund und Boden, vom Eigenheim. Makaber, nicht ohne schwarzen Humor, dass der einzige Grund und Boden, den die Mutter am Ende ihr Eigen nennen kann, das Familiengrab ist – das zu Allerheiligen und Allerseelen zu besuchen, sie aber aus unerfindlichen Gründen stets verweigert hat.
Und während Haas das entbehrungsreiche Leben dieser Mutter Revue passieren lässt, die daraus auf ihre Weise durchaus Kapital zu schlagen wusste, befindet er sich zugleich inmitten der Vorbereitungen zu seinen Frankfurter Poetik-Vorlesungen. Frappierend die Diskrepanz zwischen der abgezirkelten Welt universitärer literarischer Auseinandersetzung und dem Sterben der Mutter, der das Leben nichts geschenkt hat, die, am Ende, 95jährig, dement, doch glücklich scheint. Farbig, voller Eigensinn und mit trotzigem Beharren auf ihrem kleinen Glück versteht Haas es, sie dem Leser nahezubringen. Zärtlich und bestürzt, voll Schmerz, aber auch Komik erzählt er uns aus ihrem Leben und davon, wie es sein eigenes geprägt hat.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Carl Hanser Verlag,
München 2023
Buchtipp des Monats Oktober. November 2023

© erf
Welt im Wandel – Aufbruch zur Transzendenz
Es gibt einen Ort in uns. Wir erschaffen ihn gemeinsam,
durch unsere Offenheit und durch unseren Hustle,
durch unseren Humor und durch die wahnwitzigen
und wunderbaren Wiederholungen. Joshua Groß
Joshua Groß: Prana Extrem, Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2022
In mannigfaltiger Spiegelung schreibt sich der rasante Wandel, in dem wir als Individuen dahintreiben, in Joshua Groß‘ Roman Prana Extrem ein. Zugleich eine hellsichtige Analyse des Zeitgeists. Geprägt einerseits von dystopischen Untergangsszenarien, konterkariert wiederum von der unverbrüchlich den Subjekten innewohnenden Sehnsucht nach Transzendenz. Und sei es im Spitzensport. So vertreten durch die Figur des 16jährigen Michael Stiening, den der Ich-Erzähler Joshua in Innsbruck, Mekka des Wintersports, kennenlernt. Zur Weltklasse im Skispringen antretend, darin aufgehend, erlebt Michael im Zuge dessen mehr als nur den Triumph einer sportlichen Spitzenleistung.
[E]r beamte sich vom Tisch weg und schwebte mit einer solchen außerirdischen Eleganz den Hang hinab, dass das Publikum fassungslos verstummte – bewegungslos lag er in der Luft, bestärkt durch minimalen, dickflüssigen Aufwind, ganz gelassen reizte er seinen Flug maximal aus, bis es fast gefährlich wurde, ließ sich schließlich aber in die Senke treiben und landete mit einer todsicheren Zartheit auf den tiefgrünen Matten. Kurz war subatomar eine sakrale Stille zu verspüren. Leseprobe
Die abgeschiedene Ferienwohnung Michaels und seiner Schwester in den Alpen, inmitten der Natur, und der heiße Sommer bieten die Kulisse für die bunt zusammengewürfelte Figurenkonstellation – Ich-Erzähler Joshua und Freundin Lisa, Skispringer Michael mit Schwester Johanna, die ihn coacht, zu denen unerwartet die fünfjährige Tilde, eine Verwandte der Beiden, stößt, überdies Joshuas eigenwillige Oma. Unter der Oberfläche der lapidaren Handlung werden grundlegende Fragen menschlichen Miteinanders in einer Lebenswirklichkeit verhandelt, die von unzumutbaren Zurichtungen des Individuums geprägt zu sein schein. Dies manifestiert sich etwa im Milieu des Reihenhauses der Großeltern, dem der Ich-Erzähler „Erstickungsgefahr unter der pseudogutbürgerlichenemotionalverwahrlosten Tristesse“ Leseprobe bescheinigt. Fassungslos registriert er die
... Existenzen zweier Menschen ..., die gegenseitig in sich andauernd die eigene Abgefucktheit gespiegelt sehen ... und die unfähig sind, seit Jahrzehnten eben, auch nur kurz darüber nachzudenken, ob es Veränderungen geben könnte, die es ermöglichen würden, sich nicht nur auf erschreckende Weise aneinander abzunutzen, sondern so mit dem eigenen Leben und Sterben umzugehen, dass es innerhalb der individuellen Beschränktheiten als wertvoll empfunden wird. Leseprobe
Wie wollen wir leben, was hinter uns lassen. Wie geht ein Miteinander, getragen von Verbundenheit, Liebe.
Deutlich wird im Zuge der Lektüre der Irrwitz, in dem der Mensch des Anthropozäns angehalten ist, sich irgendwie zurechtzufinden. Was die Figuren jedoch umso nachdrücklicher dazu bringt, das vorgefundene Außen mit einem Gegenentwurf verbundenen Miteinanders zu beantworten. Die Ingredienzien hierbei sind der achtsame Umgang untereinander, Zugewandtheit und nicht zuletzt Humor.
Die Sprache, der Groß sich hier bedient, lässt, entsprechend der immer auch verzweifelt anmutenden Suche nach Sinn in der Abwärtsspirale, allzu geschliffen glatte Formulierungen vermissen, kommt – zurecht – teils sperrig, dann wieder flapsig im Jugendjargon daher, lässt aufhorchen, nimmt den Leser mit.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Verlag Matthes & Seitz, Berlin
Buchtipp des Monats September-Oktober 2023

© erf
Die Philosophin Eve Kosofsky Sedgwick spricht irgendwo von der unerschöpflichentransformativenEnergie, die gedemütigte Kinder entwickeln können. Édouard Louis
Zwischen ‚Grenzenloser Verzweiflung und unbegrenzter Zuversicht‘
Édouar Louis: Anleitung ein anderer zu werden, Aufbau Verlag, Berlin 2022. Aus dem Französischen von Sonja Finck.
Alle sprechen vom Wandel. Und es hat sich indessen herumgesprochen: Der Wandel beginnt in jedem Einzelnen. Unter Intellektuellen verpönt, predigen es die Esoteriker und spirituell Infizierten seit eh und je. Maßen sich gar an, von der schöpferischen Allmacht des Einzelnen zu sprechen. Édouard Louis hat mit Esoterik nichts am Hut ebenso wenig wie mit Spiritualität. Sein Beweggrund ist in erster Linie Rache. Rache für all die Demütigungen von Kind auf, zum einen als Angehöriger einer an den Rand gedrängten, von Armut geprägten sozialen Gruppe, überdies als Schwuler in einem solchen Kontext.
Blickt man tiefer, erweist sich das Rachemotiv als Oberfläche, unter der eine unstillbare Sehnsucht brennt und eine Ahnung Raum greift, dass wir als Mensch über ein erhebliches Potenzial an Fähigkeiten verfügen, das zur Entfaltung drängt, was nicht selten an äußerem Widerstand scheitert. Wir erleben uns dann als Opfer, hadern damit nicht selten ein Leben lang. Doch immer mehr geben sich damit nicht zufrieden, brechen aus der nach Kant selbstverschuldeten Unmündigkeit und beginnen, die Verantwortung für ihren Lebenserfolg selbst in die Hand zu nehmen.
So auch Édouard Louis, der aus diesem inneren Brennen heraus eine machtvolle, augenscheinlich durch nichts zu bremsende Energie entwickelt, Wege aufzuspüren, sich aus der Enge erbärmlicher Verhältnisse, zu der er qua Geburt verurteilt schien, regelrecht herauszukatapultieren:
Vor allem aber hatte ich versucht, meiner Kindheit zu entfliehen, dem grauen Himmel Nordfrankreichs und dem Leben, zu dem die Gesellschaft meine Freunde von damals verurteilt hatte, einem Leben der Entbehrung, in dem die einzige Aussicht auf Glück die Treffen an der Bushaltestelle sind, bei denen man aus Plastikbechern Bier und Pastis trinkt, um die Realität zu vergessen. Ich träumte davon, auf der Straße erkannt zu werden, träumte davon, unsichtbar zu sein, träumte davon, zu verschwinden, träumte davon, eines Morgens als Frau aufzuwachen, träumte davon, reich zu werden, träumte davon, noch einmal ganz von vorne anzufangen. Leseprobe
Sei es als Schüler über das Theaterspielen, sei es mit dem sicheren Instinkt für Menschen, die ihn förderten, legte er es mit entschiedener Ausdauer darauf an, Stufe für Stufe über sich selbst hinauszuwachsen. Im Zuge dessen verschafft er sich Zutritt bis in die höchsten Kreise der Gesellschaft, studiert schließlich an einer Elite-Universität, lernt Superreiche genauso kennen wie er, zwischenzeitlich in finanziellem Engpass, Erfahrungen macht, sich zu prostituieren. Ja, auch Abstiege, zumindest kurzfristig, wird er durchstehen. Aber am Ende hat er das Märchen vom Tellerwäscher zum Millionär wahrgemacht. Nein, kein Märchen. Das amerikanische Klischee hat seinen Preis, nicht zuletzt den der Entfremdung. Entfremdung von seinen Wurzeln. Und das schmerzt. So heißt es gegen Ende der akribisch betriebenen Metamorphose:
Ich glaube, ich schreibe, weil ich manchmal alles bereue, weil ich manchmal bereue, mich von der Vergangenheit abgekehrt zu haben, weil ich mir manchmal nicht sicher bin, ob meine Bemühungen zu irgendetwas nutze waren. Manchmal denke ich, dass meine Flucht vergeblich gewesen ist, dass ich um ein Glück gekämpft habe, das ich nie gefunden habe. Leseprobe
Darunter büßt der äußerliche Erfolg seiner Mission, sich kontinuierlich von seiner Herkunft zu entfernen, an Glanz ein. Und auch der Glamour, mit prominenten Schriftstellern und Philosophen auf Du und Du zu stehen, mit Ihnen aus-, bei ihnen ein- und auszugehen, in den teuersten Etablissements zu speisen, in weltbesten Hotels zu residieren und den Globus zu bereisen, weltweit seine Bücher zu verbreiten, wird am Ende wieder infrage gestellt.
Nicht infrage steht hingegen, dass wo zu Beginn Rache war, am Ende mit der zugleich aus diesem Prozess gewonnen Erkenntnis die Empathie steht: dass nämlich die Differenz zwischen seinem Leben und dem seines Vaters, von dem er sich mit all der ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen losgerissen hat, eine Folge von sozialer Ungerechtigkeit und Klassengewalt war ... Leseprobe.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Aufbau Verlag, Berlin 2022
Buchtipp des Monats September 2023

© Hartmut Fanger
Großes Theater ...
Machismo im kommunistischen Polen der 70er Jahre und Gewalt gegen Frauen
Dorota Masłowska: Bowie in Warschau, Rowohlt Verlag, Berlin, Januar 2023. Aus dem Polnischen von Olaf Kühl.
In diesem Buch der erfolgsgekrönten polnischen Autorin Dorota Masłowska ist vieles anders als Genrebezeichnung und Titel es vermuten lassen.
Wer einen Roman im klassischen Sinne erwartet, sieht sich getäuscht. Stattdessen werden wir von Beginn an mit großem Theater, mit Regie- und Sprechanweisungen für die Bühne konfrontiert. Eine Inszenierung, die in Polen dann auch als Theaterstück zu erleben ist. Und wer sich unter besagtem Titel ein Buch über David Bowie vorgestellt hat, wird gleichfalls enttäuscht. Nur kurz, zu Beginn und am Ende, tritt der britische Sänger, Liedermacher und Rockstar in Erscheinung. So wie er sich auch in Wirklichkeit 1973 nur kurz in Warschau aufgehalten hat. Die Tatsache, dass er sich vor Ort in einem Buchladen mit polnischen Schallplatten eingedeckt und später mit «Warszawa» ein bemerkenswertes Musikstück geschaffen hat, reicht der 1983 geborenen Autorin aus, um ihre Fantasie spielen zu lassen und ein kontrastreiches Bild vom Polen der frühen 70er Jahre zu zeichnen. Der sich auf der Fahrt mit dem Zug zwischen Moskau und Berlin in Warschau aufhaltende Musiker wiederum steht in sinnfälligem Widerspruch zum realen Kommunismus dieser Zeit, wirkt wie aus dem Himmel gefallen. (Nicht zu verwechseln mit dem Science-Fiction-Film „Der Mann, der vom Himmel fiel“ aus dem Jahr 1976, in dem David Bowie die Hauptrolle spielt)
Doch Bowie selbst spielt hier, wie oben bereits angedeutet, eben nicht die Hauptrolle. Von ihm ist dementsprechend wenig zu erfahren. Stattdessen wird jede Menge einer von Armut geprägten Gesellschaft offenbar, in der, was die Beziehung zwischen Männern und Frauen anbelangt, archaische Verhältnisse vorherrschen. Gewalt gegen Frauen das eigentliche Thema. Nicht umsonst schreibt der Polizeizugführer Wojciech Krętek gleich zu Beginn davon, dass zwar auf der einen Seite ‚Neue Stadtviertel emporschießen, prosperierend, modern, zum anderen jedoch die alten verkommen‘. Letztere bezichtigt er als
„Schnapsnester. Kuppelbuden. Versiffte Löcher an der Aleje, darin fünfzehnjährige Prostituierte. Von ihren Stenzen werden sie kurzgehalten. Ich nenne sie Zahnärzte, denn die Mädchen kriegen regelmäßig ihre Vorderzähne per Faust entfernt.“ Leseprobe
Zwei Frauen verkörpern die Hauptrollen: Da ist zum einen jene erschöpfte und ewig putzende Frau Nastka, „... die nach Jahren unter Dauerbeschuss von Unglück und Schicksalsschlägen wie vierzig und achtzig zugleich aussieht“ Leseprobe, zum anderen die schöne und träge Regina, die, nicht weit von Suizid entfernt, die Absicht äußert, sich gleich in die Weichsel zu stürzen. Die eine wird von ihrem Mann wie ein Gegenstand behandelt, die andere geschlagen.
Harte Themen also, jedoch satirisch überzeichnet und immer wieder komisch, dabei mit Verve, erzählt. Und Bowie eignet sich prima als Art Pendant dazu, da er wie von einer anderen Galaxie in Erscheinung tritt und das Leben der Protagonisten gehörig durcheinanderbringt. So wird er von besagtem Polizisten als jener „Damenwürger“ verdächtigt, der einst ganz Warschau in Schach gehalten hatte, vom schriftstellernden Buchhändler wiederum mit dessen Erzfeind und erfolgreichen Autor Krempiński verwechselt.
Am Ende muss Bowie im Zuge einer irrwitzigen Hetzjagd aus Warschau flüchten. Wie es dazu gekommen ist und was das für den Einzelnen bedeutet, lesen Sie auf den letzten Seiten. Bis dahin jedoch mögen Sie jede Menge Unterhaltung mitnehmen, reines Lesevergnügen anhand bestechend scharfer Dialoge und manch überraschender Wendung, kurz, sich von der Schreiblust der Autorin – vom Übersetzer übrigens blendend transportiert – anstecken lassen.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt Verlag in Hamburg
Buchtipp des Monats August 2023
Unsere Liebe war älter als wir selbst. Kein Verbrechen, noch nicht einmal der Tod,
konnte ihr ein Ende setzen. Wir hießen Isis und Osiris, Zeus und Hera ...
Gudrun Hammer

©
erf
Die Wahrheit hinter den
Bildernas
Gudrun Hammer, Paul oder: Besuche in der Bilderkammer. Novelle, Dreiviertelhaus Verlag, Berlin 2023
Im Zentrum dieser so komplexen, vielschichtigen wie dichten Novelle mit Schauplatz Hamburg steht die Ich-Erzählerin und Protagonistin Johanna sowie die große Liebe ihres Lebens. Als Schulkind einst bezichtigt, von überschießender Fantasie zu sein, deshalb im Deutsch-Aufsatz nicht selten kläglich scheiternd, konnte dies ihre Liebe zu den Wörtern nicht trüben, die sie schließlich auch zum Beruf gemacht hat und als freie Lektorin arbeitet. Dort befähigt sie eben diese Fantasiebegabung, gepaart mit Empathie, in die fiktiven Welten ihrer Kunden einzutauchen, falsche Töne, mangelnde Erzähllogik oder überflüssigen Ballast darin aufzuspüren. Selbst schreibt sie nicht. Und das hat Gründe. „Ich hatte nur eine Geschichte zu erzählen, meine, nein unsere Geschichte, und von dieser Geschichte kannte ich nur die eine Hälfte. Bisher.“ Leseprobe
Alle lieben Paul. Die Ich-Erzählerin, ihre Mutter und ihre Schwester. Paul, Johannas Halbbruder und zwölf Jahre älter als sie. Als Baby hatte er sie gewickelt. Ihr den Weg zur Liebe zu den Wörtern und der Welt der Literaturen eröffnet, indem er sie im Familienkreis – als Schulkind, noch kaum des Lesens mächtig –auffordert, eine Passage aus Moby Dick zu lesen.
Es war ein voller Erfolg. In Blitzgeschwindigkeit reihte ich Silbe an Silbe, mein Fingerzeig wies mir den Weg von Zeile zu Zeile. Der Sinn, den das alles ergab, war mir egal. Ich versetzte mich selbst und meine stillen Zuhörer in einen Geschwindigkeitsrausch. Silben, die zu Wörtern wurden, Wörter, aus denen Sätze wurden, rasten von mir zu ihnen, vorgelesene Satzzeichen gaben ihnen Orientierung in einem atemlos vorgetragenen Text. ... Leseprobe
Die Liebe Johannas zu Paul schien festgeschrieben in ihrer beider Seelenplan. Allenfalls dazu angetan, die Liebenden dazu zu nötigen, sich auf eine Reise ins Innerste ihrer selbst zu begeben. Und wie Liebesgeschichten eigen – von glücklicher Liebe wird selten erzählt –, kommt es auch zwischen Johanna und Paul jäh zur Trennung, als Paul beschließt, zur See zu fahren. Gefolgt von der Nachricht seines Selbstmords im Japanischen Ozean.
Allein, Johanna weiß tief in ihrem Inneren, Paul lebt. Niemals würde er sich umbringen. Und 30 Jahre später, Johanna ist in ihren Fünfzigern, begegnet sie ihm wieder. Auf dem Friedhof anlässlich der Suche mit Freundin Verena nach dem Grab einer gemeinsamen Freundin, die sich das Leben genommen hatte. Da sieht sie ihn flüchtig, am Grab einer Frau stehen, Elena Mertens, geboren 1951, gestorben im Mai 2001. Dies genügt, ihn ausfindig zu machen. Er betreibt indessen ein Fotoatelier in Altona, gibt sich als Hans Schröder aus. Er kenne keinen Paul. Sämtliche Beweisstücke, die Johanna an ihn heranträgt, prallen an seiner Wirklichkeit ab.
Einmal führt er sie durch die Fotoausstellung in seinem Atelier, seitenlange Passage, geflutet von Erinnerungsbildern aus ihrer gemeinsamen Zeit. „So kam es, dass wir langsam von Bild zu
Bild gingen. Zwölf Farbfotografien, sechs an jeder Wand, allesamt im Querformat und gleich groß.“ Leseprobe Meist Stillleben. Und fast auf jedem Foto erkennt Johanna Details aus ihrem früheren gemeinsamen Leben. Andererseits wiederum wirkt eine der Fotografien wie vor langer Zeit gemalt, durchbrochen allenfalls von einem winzigen Detail, wie das unter einem dicken Buch verdeckte Handy, das diese Vorstellung konterkariert.
Das Ganze angelegt als Art Vexierspiel, in dem Erinnerungsbilder in rasantem Tempo sich kreuzen, überlagern, Gedankensplitter Fährten legen, die sich wieder verlaufen. Tote sich zu den Lebenden gesellen, Lebende wiederum ins Totenreich geladen scheinen, über ethisch-moralische Belange zu debattieren, ebenso wie die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit immer wieder verwischt. Wie überhaupt Wirklichkeit zunehmend als Konstrukt erscheint, wonach Wahrheit, Halbwahrheiten und Lügen in Anlehnung an Michel de Montaigne als ‚unbegrenztes Feld hunderttausender Spielarten‘ zu betrachten seien. Dabei verdichten und verschieben sich Bedeutungsebenen und Zeitlinien. Spiegelfiguren wie Johanna und Schriftstellerin und Selbstmörderin Katharina, aber auch die der fünfzehnjährigen Johanna und der jungen Frau im selben Alter im Dunstkreis von Paul alias Hans Schröder, die ihn offenkundig anhimmelt, verweben sich überdies in das engmaschige Beziehungsgeflecht. Der Leser wiederum kann sich dem von dieser Lektüre ausgehenden Sog schwerlich entziehen, legt das Büchlein, einmal begonnen, nicht mehr aus der Hand, bis es denn ausgelesen ist und ihn mit einem Rätsel zurücklässt. Wer war Paul?
„Die Wahrheit, das war seine Stimme, die eine, unverwechselbare Stimme ... Lüge, Wahrheit, was heißt das schon. Vielleicht glaubte er ja selbst, was er sagte, vermischte schon lange Wahres mit Erfundenem und konnte selbst irgendwann beides nicht mehr auseinanderhalten.“ Leseprobe
Das alles entscheidende Treffen von Johanna und Paul in der Traube kulminiert in einem fulminanten, zugleich unspektakulär daherkommenden Schluss der Novelle, so überraschend wie offen. Die Klaviatur der Kunst des Schreibens bespielt Hammer so virtuos wie souverän.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Dreiviertelhaus Verlag!
Buchtipp des Monats Juli 2023
© Hartmut Fanger:
Von Schlangen, Zecken und Überflutungen – Wenn der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten ist . Weltuntergangsszenario à la Boyle

T.C. Boyle: Blue Skies, aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren, Hanser Verlag, München 2023
Bereits vor 20 Jahren hat T.C. Boyle in seinem Roman „Ein Freund der Erde“ von einer Klimakatastrophe erzählt. Eine Warnung, die schon deswegen in seinem neusten Werk „Blue Skies“ an Brisanz nicht mehr zu übertreffen sein mag. Die hierin geschilderten Waldbrände in Kalifornien und Überschwemmungen in Florida basieren auf einem ganz realen Hintergrund. Ebenso der Sturm, den er einem Interview von NDR Kultur nach ebenso selbst erlebt hat und wobei in seiner unmittelbaren Nachbarschaft 23 Menschen gestorben sind.
Nichtsdestotrotz liest sich das Buch bei allem Ernst der Lage, vielerlei tragischen Elementen und einer grundlegend dystopischen Weltuntergangsstimmung in typischer T.C. Boyle-Manier streckenweise sogar heiter und vergnüglich. Dies liegt nicht zuletzt an den frappierend unbedarft bis naiv gezeichneten Protagonisten, die, jeweils in ihrer eigenen Blase und dementsprechenden Mustern gefangen, den Versuch unternehmen, sich mit den extremen Gegebenheiten zu arrangieren. Sei es Cat, die sich aus Langeweile heraus Schlangen kauft, ohne zu wissen, in was für eine Gefahr sie sich, ihren Lebenspartner und ihre Kinder bringt. Oder ihr Bruder, der ausgerechnet als Entomologe einen winzigen Zeckenbiss unterschätzt, weshalb ihm am Ende ein Unterarm abgenommen werden muss. Währenddessen geht es im Umfeld hoch her. So schildert T.C.Boyle so plastisch wie drastisch die Umweltzerstörung vor Ort – Artensterben, Missernten, Wasserknappheit. Von den zunehmenden Wetterkatastrophen ganz zu schweigen, sei es Hitze und Trockenheit in Kalifornien oder die nimmer enden wollenden Regengüsse in Florida inklusive gewaltiger Überflutungen. Dabei versteht es der Autor immer wieder, seine Leser in den Bann zu ziehen. So zum Beispiel mit der Schilderung eines Hurricans, der eine Hochzeitsfeier zunichte macht, oder der Moment, wo Cat kurz vor der Geburt ihrer Zwillinge steht, sich allein im Haus befindet, ihre Mutter, die einzige, die ihr noch helfen kann, während eines Tornados mit Flugzeug und Leihwagen zu ihr unterwegs ist. An Spannung kaum zu überbieten.
„Blue Skies“ ist Boyles 19. Roman und vielleicht nicht der ganz große Wurf – dementsprechend auch nicht zu vergleichen mit „América“, „Wassermusik“ oder „Drop City“. Dafür aber bietet er beste Unterhaltung und erzählt mit einer Dringlichkeit, dass es auch dem letzten Klimaleugner langsam einleuchten sollte, dass weit mehr als bisher dagegen gesteuert werden müsste.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Hanser Verlag in München
Buchtipp des Monats Juni 2023

© Hartmut Fanger
Das eigene Leben als Stoff zum Schreiben
Judith Hermann: Wir hätten uns alles gesagt, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2023
Seit 1959 findet sich alljährlich ein Autor/eine Autorin als Gastdozent/in an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main ein, um im Rahmen einer Vortragsreihe ein Semester lang Fragen über den Schaffensprozess und die Umstände literarischer Gegebenheiten zu erörtern. Betrachtet man die Liste der Vortragenden, so ist schnell klar, hier ist das Who is Who der deutschsprachigen Literatur vertreten – dementsprechend legendär indessen die Frankfurter Poetik-Vorlesungen, worunter besagte Reihe bekannt wurde. Von Ingeborg Bachmann bis Heinrich Böll, von Hans Magnus Enzensberger bis Martin Walser, von Elisabeth Borchers bis Julie Zeh und viele, viele mehr. 2022 hatte nun Judith Hermann die Ehre, woraus schließlich der vorliegende Band „Wir hätten uns alles gesagt“ entstanden ist.
Doch wer hier lediglich einen Sachtext über Literatur im Allgemeinen und das Schreiben im Besonderen erwartet hat, wird angenehm überrascht sein. So heißt es gleich zu Beginn: „Das Schreiben über das Schreiben ist offenbar und erwartungsgemäß eigentlich vermieden worden, stattdessen haben sich Menschen und Situationen aufgezeigt, die das Schreiben beeinflusst haben“. Und Judith Hermann versteht es im Zuge der Schilderung ihres Schaffensprozesses auch in diesem Band, weitere Geschichten – und zwar Geschichten aus ihrem Leben – zu erzählen.
Und so überrascht es auch nicht, dass der Stoff aus all ihren großen Erzählbänden ihr tatsächliches Leben zum Inhalt hat: „Ich schreibe über mich. Ich schreibe am eigenen Leben entlang, ein anderes Schreiben kenne ich nicht.“
Dabei lässt sie uns wissen, dass sie während ihrer Arbeit nie sicher sein kann, inwieweit das, was sie von sich erzählt, wenn sie autobiografisch schreibt, tatsächlich stattgefunden‘, was sie womöglich nur ‚geträumt‘ oder sich ‚nur ausgedacht hat‘, weshalb ihre Erinnerung sich, literarisiert, der Fiktion annähert, was wir schließlich wiederum unter dem Begriff Autofiktion verstehen. Autofiktionales Schreiben also das Stichwort. Nicht umsonst heißt es an einer Stelle: „Schreiben imitiert Leben, Verschwinden der Dinge, beständiges Zurückbleiben, Unscharfwerden, Erlöschen der Bilder.“
Spannend gleich zu Beginn die Geschichte mit ihrem Psychoanalytiker Dr. Dreehüs, dem sie eines späten Abends zufällig auf der Straße begegnet, weshalb sie wieder zu rauchen beginnt und sich von ihm in einer Kaschemme zu einem Gin Tonic einladen lässt. Und wie einer Analyse eigen, werden auch hier all die Erinnerungen wach, Erinnerungen an die Stunden, die sie bei ihrem Analytiker verbracht hat. So etwa an die Entstehung des 17 Erzählungen umfassenden Bandes, „Lettipark“ zur selben Zeit, den wir bereits im Februar 2018 (siehe Archiv) vorgestellt hatten und den sie am Ende Dr. Dreehuis zukommen lässt, ihrer langjährigen Freundin Ada hingegen verweigert. Eine weitere authentische Geschichte.
Die Psychoanalyse ist es schließlich auch, die bisher Verdrängtes und Traumatisches wachruft, was summa summarum natürlich eine Fülle weiterer lebensnaher Geschichten beinhaltet. Dabei spielen Träume, Fantasien, insbesondere Erlebnisse in der Kindheit eine eklatante Rolle. Wobei sich der Autorin die Frage stellt, inwieweit es für sie ‚quälend, harte Arbeit ist, so eine Geschichte zu schreiben‘, oder dies eher ‚beglückend, unterhaltsam‘ sein kann, „am Ende ein Geschenk.“
So erzählt Judith Hermann zum Beispiel die Geschichte von ihrem Vater, wie er sie als Kind mit zur Aufbahrung des geliebten Großvaters nimmt, ohne sie vorher auf irgendeine Weise darauf vorzubereiten. Zugleich fallen in diesem Zusammenhang die ‚Kratzer‘ an den Händen des Vaters auf. Dieser erzählt ihr, dass diese von dem Kuscheltier kämen, in das es sich nach dem Tod der ‚echten‘ Katze verwandelt hätte. Dass das Kind eine solche Fantasie nicht verstehen kann, liegt auf der Hand.
Oder das überdimensionale Puppenhaus, das er ihr gebaut hat, um davon zu erzählen, dass darin des Nachts ein seltsames Wesen haust, was dem Kind natürlich regelmäßig Angst einjagt und weshalb die Autorin sich heute noch beim Verfassen eines Textes darüber allein fühlt. Viele Anekdoten und Überraschungen folgen.
Und das alles in gewohnter Judith-Hermann-Qualität erzählt. Das hat sich seit „Sommerhaus später“ nicht verändert. Sensible Beobachtungen, sprachlich nuancenreich, knapp und vielstimmig umgesetzt. Es bedarf auch hier nur weniger Worte um für Kopfkino zu sorgen. Ein Kleinod in der Kunst der kurzen Form, der Kunst des Aus- und Weglassens.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem S. Fischer Verlag Frankfurt am Main

Buchtipp Mai 2023
© Hartmut Fanger
Einsamkeit ist meine Einzimmerwohnung, ich unter der Bettdecke, die mich ganz einhüllt. Sie ist unter demselben Himmel, zu dem ich während eines Spaziergangs hinaufstarre, ist das Gefühl der Entfremdung inmitten von Partygästen. Baek Sehee
Psychotherapie auf Koreanisch
Eine so heitere wie ernsthafte Auseinandersetzung mit
einer anhaltenden leichten Depression (Dysthymie )
Baek Sehee: Ich will sterben, aber Tteokbokki essen will ich auch, Rowohlt Verlag, Hamburg 2023
Vom Rowohlt Verlag als „Überraschungs-Bestseller aus Südkorea“ angekündigt, kommt diese Geschichte in Dialogform tatsächlich so ungewöhnlich, selbstironisch und witzig daher, wie es der Titel verspricht. Die 32 jährige Autorin Baek Sehee erzählt auf 230 Seiten aus der Perspektive einer nach außen hin erfolgreichen jungen Angestellten in der Social-Media-Abteilung eines großen Verlagshauses, an der innerlich jedoch jede Menge Selbstzweifel nagen, denen sie innerhalb von 12 Wochen im Rahmen von Gesprächen mit einem Psychologen auf die Spur kommen will.
Und da stellen sich für die Protagonistin eine Fülle an Fragen. Zum Beispiel, inwieweit sie eine Lügnerin ist, wenn sie ihre Selbstzweifel nicht zeigen kann. Wie es möglich ist, sich selbst besser kennenzulernen, oder was man dagegen unternehmen kann, wenn man sich unter ständiger Beobachtung wähnt, das Selbstwertgefühl fehlt, sich als Frau nicht besonders attraktiv fühlt. Eine grundsätzliche Generalüberholung der Seele scheint notwendig.
Auf die Frage des Therapeuten am Ende, inwieweit die Ich-Erzählerin aufgrund von ‚Vorurteilen und Normen vielleicht das eigentliche Ziel aus den Augen verloren haben könnte’, stellt diese fest, dass sie ‚sehr froh’ sei, ,Kreatives Schreiben studiert zu haben’. Und genau das bestätigt ihr dann auch der Therapeut. Es sei ‚egal, was andere sagen, wichtig sei, was gefällt und Freude mache’.
Dies und viele weitere Beispiele zeigen ein ganzes Stück Lebenshilfe auf. Es geht schließlich darum, ‚ein besseres Gespür für sich selbst zu entwickeln‘, sich darüber klar zu werden, was man wirklich will. Es komme weniger darauf an, sich damit zu beschäftigen, wie man auf andere wirke. Ebenso wenig wie offenbar auch der Verstand immer der beste Ratgeber sei, vielmehr solle man öfter auf sein Herz hören.
Ein Buch, das zugleich den enormen Leistungsdruck im Arbeitsleben spiegelt, dem die jüngere Generation heute ausgesetzt ist, die sich schwertut, im Auge zu behalten, dass bei allem Eifer die Seele nicht zu kurz kommen darf, es noch andere Werte gibt.
Psychologische Erkenntnisse und Reflektionen unterstützen den Hilfesuchenden dabei. Der Dialog, hier als Stilmittel eingesetzt, dient zugleich als Vehikel, das die Handlung vorantreibt, und wird durch kurze Abschnitte konterkariert, die sowohl kleinere Alltagssorgen wie die großen Fragen des Lebens reflektieren und sich auch jeweils im Titel der einzelnen Kapitel widerspiegeln, was dem Ganzen einen gewissen Charme verleiht.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt Verlag in Hamburg

© Hartmut Fanger
Glück und Leid im Alltag eines Autors
Arno Geiger: Das glückliche Geheimnis, Hanser Verlag. München 2023
Dies jüngste Werk Arno Geigers ist eine wahrhaft beglückende Lektüre, zugleich Fundgrube für alle, die das Schreiben für sich als Medium erkannt haben, das eigene Leben aus einer erweiterten Perspektive heraus anders wahrzunehmen und neu zu bewerten, sowie als Möglichkeit, sein schöpferisches Potenzial zu verwirklichen. Werfen wir in „Das glückliche Geheimnis“ mit Geiger selbst einen Blick zurück auf seine vorausgegangenen Romane, „Es geht uns gut“, „Selbstporträt mit Flusspferd“, „Alles über Sally“ oder „Der alte König in seinem Exil“, lässt sich daraus durchaus eine Erfolgsgeschichte ablesen, aber auch, dass jeder Erfolg offenbar unweigerlich seinen Preis hat.
Auf 240 Seiten gewährt uns der Autor Einblick in die Entstehungsprozesse seiner Romane, in die diesen begleitenden Umstände sowie die Einsichten, die er dabei gewonnen hat. So zum Beispiel, inwieweit er eine Art Doppelleben geführt hat und Tag für Tag, vornehmlich zu Fuß oder per Rad, mehr oder weniger heimlich seine Runden drehte, um in Altpapiertonnen nach brauchbarem Material zu suchen. Darunter Briefe und Tagebuchaufzeichnungen. Im Zuge dessen bewahrheiten sich für ihn zusehends die Erkenntnisse seiner Vorbilder wie etwa Lew Tolstoi oder Ludwig Börne. So, dass Menschen, die für ‚den Hausgebrauch‘ schreiben, im Grunde das ‚einlösen’, was viele Schriftsteller vermissen lassen. Laut Börne sei in der Kunst
[s]ich unwissend zu machen ... die große Kunst. Denn an nichts herrsche größerer Mangel als an Büchern ohne Verstand. Das Geburtsland des Gedankens sei das Herz ... Nicht an Geist, an Charakter mangle es den meisten Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Es fehle ihnen an Mut zur Ehrlichkeit, ihre Eitelkeit stehe ihnen im Weg ... Aufrichtigkeit sei die Quelle aller Genialität. Leseprobe
Dementsprechend trifft er bei seiner Suche auch auf so manches Buch, das er dann ‚anders als in gekauften Büchern, in freudiger Erregung liest’. Doch was, wenn er dort ein Buch von sich selbst findet ...?
Mit einfachen Worten, stichhaltig, plastisch, dabei gewürzt mit feinem Humor, zeichnet Geiger seinen Werdegang als Schriftsteller, von anfänglicher Erfolglosigkeit bis hin zum Autor, der binnen kurzer Zeit ‚fast halbmillionfach’ Bücher verkauft. Ein Erfolg, der sich, wie er selbst es ausdrückt, ‚wie durch den Kamin mit Poltern und Getöse’ einstellte. Denn schon bald ziehen die zahllosen Fernsehauftritte, Podiumsdiskussionen, Preisverleihungen und jede Menge Lesungen Zustände der Erschöpfung bis hin zum Burnout nach sich und zeugen davon, wie von dem Traum eines jeden Autors ein Alptraum werden kann. Dabei war es auch für Geiger wahrlich nicht immer einfach, seine Werke bei einem Verlag unterzubringen.
Und wie im richtigen Leben geht es im Werk Geigers auch um handfeste Beziehungen. So werden hier ebenso Geschichten von der Liebe erzählt. Von der Liebe zu seiner einstigen Freundin M., zur Geliebten O. und seiner heutigen Frau K., die, direkt oder indirekt, ihren Beitrag zu dem Erfolg seines Werks beigetragen, ihn unterstützt und ihm immer wieder den Rücken freigehalten haben.
Und natürlich kommen auch die uns allen anhaftenden Themen existentieller Herausforderungen zum Tragen. So anrührend wie erschütternd die Schilderungen von Krankheit und Tod, sei es von dem eines guten Freunds, sei es von Verwandten, wie der Schlaganfall seiner Mutter und die Demenzerkrankung des Vaters. Geiger zieht nicht zuletzt daraus die Erkenntnis, zu der schon der geschätzte verstorbene Freund gelangt war: „Das Leben ist eine Zumutung.“
Geiger kommt in diesem Buch der Wahrheit, zumindest seiner, sehr nahe, auch wenn für ihn klar ist, dass er ‚über das eigene Leben nur schreiben kann, indem er es verfälscht’. Für ihn gibt es dennoch keinen Unterschied, wenn er zum Beispiel seinen Vater beschreibt. Da ist er Sohn und Schriftsteller zugleich. Wie er überhaupt als Schreibender ‚mehr als nur Schriftsteller’, sondern zugleich ‚Lebensgefährte, Sohn, Künstler, Lumpensammler, Gauner, Bruder, guter und schlechter Freund, alles in einem sei’ – nach Ernie Ernaux und anderen ein weiteres Beispiel Autofiktionalen Schreibens, der Erforschung des eigenen Lebens geschuldet.
Eine nicht nur für die schreibende Zunft sowohl geistreiche, tiefgreifende als auch unterhaltsame Erzählung. Lichtblick in dunklen Zeiten! Aber lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Hanser Verlag München
Buchtipp des Monats März 2023

© Hartmut Fanger: Gefangen im Kosmos von Kiindheit & Jugend
Mircea Cărtărescu, Melancolia, Paul Zsolnay Verlag, Wien 2022, Aus dem Rumänischen von Ernest Wichner
Nach dem überaus erfolgreichen und zum Bestseller avancierten Roman „Solenoid“ sind von Mircea Cărtărescu nun auf 272 Seiten fünf Erzählungen erschienen, die zusammen genommen einen in sich geschlossenen Zyklus bilden. So fungiert die Erzählung „Der Tanz“ als Prolog, „Das Gefängnis“ wiederum als Epilog für die drei Erzählungen in dem mit „Melancolia“ betitelten Hauptteil. Und es ist die Einsamkeit, die sich darin hindurchzieht wie ein roter Faden.
Nicht zu unrecht wird der 1956 geborene Literaturdozent und Dichter gern mit Marcel Proust verglichen, der in „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ mit Hilfe des Duftes der Madeleine – des durch Proust zur Berühmtheit erlangten Gebäcks – Vergangenheit so gegenwärtig wie lebendig werden lässt und für den ‚eine Stunde nicht eine Stunde ist, sondern ein mit Düften, mit Tönen, mit Plänen und Klimaten angefülltes Gefäß‘.Und so wird auch in Mircea Cărtărescus Erzählungen in sinnlicher Wahrnehmung Vergangenes gegenwärtig und eine von Einsamkeit geprägte Kindheit und Jugend authentisch vor Augen geführt. So können wir zum Beispiel in „Die Stege“ die Verlassenheit des Kindes im Zuge der Abwesenheit der Mutter gut nachvollziehen, seine von Angst beherrschte Vorstellungswelt, dass sie vom Einkaufen nicht mehr zurückkehren könnte. Unter dem Blick des Jungen wird die Umgebung lebendig: die billigen, ,schlampig lackierten Möbel’, das mit ‚hässlichen Nippesfiguren’ bestückte Bücherregal, der ‚vergilbte Vorhang’, der ‚schwarz vor Staub“ erstarrte Fensterrahmen. So ergreifend wie bildhaft wiederum führt der Autor vor Augen, wenn ‚die Luft kalt und verschwiegen’ ist, ‚das Licht auf den Abend hinwelkt‘, oder ‚die Stille das Kind mit all ihren Kräften drückt ...’
Beunruhigend wiederum die so märchenhaft wie fantastische Erzählung „Die Füchse“, mit denen der achtjährige Marcel und seine dreijährige Schwester Isabel in ihrer Fantasie spielen, was ihnen kurzfristig hilft, sich in eine heile Parallelwelt zu flüchten. Letztere wird eines Abends jedoch durch die mit einem Mal aufkommende Angst vor eben diesen Füchsen, Krankheit und Tod durchbrochen. Nicht von ungefähr vergeht der kleinen Isabel das Lachen, Angst beherrscht sie nun. Schließlich wird sie tatsächlich von einem Fuchs entführt, wobei es um Leben und Tod geht. Marcel bleibt keine Wahl. Um seine Schwester zu retten, muss er sich opfern. Die dem Fuchs eigene Einsamkeit wird dabei von Marcel übernommen.
In der Erzählung „Die Häute“ wiederum bewegt sich die pubertäre Hauptfigur Marcel, für den nichts auf der Welt einen Sinn hat’, .zwischen zwei Altern’, sprich Kindheit und Erwachsensein. Die dabei ihn peinigende Einsamkeit bringt ihn an den Rand des Selbstmords, wenn die Kindheit als ‚noch strahlend behaftet, mit jenem stumpfen Glanz der Seide, dem man auf manchen alten Gemälden begegnet’ beschrieben wird. Der Gymnasiast liest seine Lieblingsdichter und hält sich fern von der äußeren Welt, der er sich zunehmend entfremdet. Im vitalen Gegensatz dazu das wachsende Interesse am anderen Geschlecht. Und so wie es für ihn selbstverständlich erscheint, dass ein Mann alle paar Jahre seine Haut wechselt, stellt sich dem Heranwachsenden die Frage, inwieweit dies auch für Frauen gilt.
Empfehlenswerte Lektüre, die den Leser in eine von Kindheit und Jugend geprägte Welt entführt und mit Sinn für Poesie und Sprachkraft zu fesseln vermag. Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Zsolnay Verlag Wien

Buchtipp des Monats März 2023
© erf
Vom Verschieben der Zeit
Etel Adnan, Zeit. Gedichte, mit einem Nachwort von Klaudia Rutschkowski, Edition Nautilus, Hamburg 2021
„Schreiben stammt aus einem Dialog/mit der Zeit: es besteht/aus einem Spiegel, in dem das Denken/entblößt wird und sich/ nicht mehr erkennt“ Leseprobe – besagter Gedichtband in fünf Zeilen auf den Punkt gebracht, lyrische Zeichen aus Werden und Vergehen.
Anlass, die hier versammelten Poeme zu Papier zu bringen, war eine Postkarte, die Adnan am 27. Oktober 2003 von ihrem langjährigen Freund, dem tunesischen Dichter Khaled Najar, erhielt. Ihre Antwort erfolgte umgehend und ist hier in der ersten von sechs Sequenzen unter dem Titel „27. Oktober 2003“ nachzulesen. Insgesamt 13 Jahre steht sie im Zuge der Arbeit an dem Gedichtband im Austausch mit dem Dichterfreund. 2016 schließt sie ihn unter dem Titel „Baalbek“ ab – für Adnan mit seinen Tempeln und Ruinen ein mythischer Ort und Provinzhauptstadt im Libanon. Zusammen mit der New Yorker Dichterin und Künstlerin Sarah Riggs überträgt sie ihn aus dem Französischen ins Englische und wird 2020 dafür mit dem Griffin Poetry Prize, dem weltweit höchst dotierten Lyrikpreis, ausgezeichnet.
Die freien Verse fließen, einem reißerischen (Bewusstseins-) Strom gleich, in ein nicht definierbares Offenes, das die Grenzen unserer in Vorgaben und Konventionen gefangenen Wahrnehmungsmuster außer Kraft setzt: „in virtueller Klarheit und virtuellem Raum/vom Göttlichen heimgesucht, singen die Vögel vor/Ohren der Kerzen den Schmerz des Lebens,/denn Glück ist unerträglich ...“ Lesesprobe Zugleich ziehen sich Trauer und Schmerz angesichts der Vergeblichkeit menschlichen Strebens, der Diskrepanz zwischen Schönheit und enthusiastischer Feier des Lebens, der Liebe und der Allgegenwärtigkeit von Tod, Gewalt und Zerstörung wie eine Blutspur durch den gesamten Gedichtband. Dies gemahnt an Walter Benjamins „Angelus Novus“, einem Gemälde von Paul Klee, von Benjamin als Denkbild unter dem Titel „Engel der Geschichte“ ausgewiesen, mit rückwärtigem Blick auf die Geschichte des Menschen, einer einzigen Katastrophe, wo Trümmer auf Trümmer sich häuften.
„ich liebe den Regen, wenn er/mich wie ein Fluss/umfängt. mich in die Wolken verpflanzt./ich teile das Eigentum/des Himmels. ich wachse/wie ein Baum ...“ Lesesprobe Die unverbrüchliche Liebe zur Erde und ihrer schöpferischen Energie – Adnans Mutter lehrte sie das Brot zu küssen und sich bei der Erde, die uns trägt, zu bedanken – wird konterkariert durch das Unvermögen des Menschen, dies Gut als seine Lebensgrundlage entsprechend wertzuschätzen, es vielmehr in rasanter Manier zunehmender Zerstörung preiszugeben.
„Sterne verlöschen/alle paar Sekunden; die Zeit,/die Information braucht, um/Welten zu durchqueren ...“ Zeit, linear und chronologisch als Strukturprinzip, erweist sich bei Adnan gleichwohl als vergebliche Kategorie, „wenn wir schreiben, können wir nicht/singen, wenn wir schlafen, können wir/nicht leben//Erinnerung ist die meiste Zeit/für nichts gut: die Hotels, in denen ich wartete,/sind verschwunden ...“ Leseprobe Halt- und rastlos scheint der Mensch seiner Existenz ausgesetzt, Ambivalenz und Zerrissenheit erweisen sich als Kehrseite der menschlichen Ordnungen. Und so taumeln wir als Spezies offenbar auf eine Art Nullpunkt zu, kurz davor, uns selbst auszulöschen, – „sieh deine Brüder im Fernsehen/sterben, und rühr dich nicht ...“ Leseprobe , oder aber, wie es die Verse Adnans nahelegen mögen, unser Bewusstsein in eine andere Dimension, eine Dimension kosmischen Ausmaßes, zu transzendieren: „sie sind in einer neuen Welt,/wenn auch ohne Ausgang ...“ Leseprobe
Eben dies leistet die Lyrik Adnans, in der sich hinter vordergründigem Chaos und Zerstörungswut Liebe und Zugewandtheit zum Menschen, zur Welt, zur Natur, dem Meer und den Bergen, und zur Kunst Bahn brechen, die Zeit sich auflöst in ein ewiges Sein und kosmisches Bewusstsein, das zu erlangen uns aufgetragen sein mag. „verlass deine Kindheit nicht und ihren/Kummer. der erste Wunsch wird dich bis zum letzten/Atemzug begleiten. Straßen führen/zu Erleuchtungen, aber nie zum Frieden/des Herzens“ Leseprobe
Ebenso wenig vordergründig vermitteln sich im lyrischen Gestus Adnans Hoffnung oder Trost, als sich vielmehr in ihrer Sprache eine Leuchtkraft manifestiert, die auf etwas Größeres, uns als Spezies jedoch Innewohnendes verweist, das erst noch einzulösen wäre. Adnan erweist sich damit als große Visionärin, ihrer Zeit voraus.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt der Edition Nautilus, Hamburg
Buchtipp des Monats Februar - März 2023

© erf: SCHREIBEN OHNE GELÄNDER
Die Gefangenschaft ist das menschliche Los.
Machen wir uns nichts vor.
Etel Adnan in „Paris, Paris” [Prosawerk]
Die Poesie erfasst das Unsagbare und lässt es ungesagt.
Etel Adnan in „Die See” [Gross-Poem]
Etel Adnan: Sturm ohne Wind. Gedichte – Prosa – Essays – Gespräche, herausgegeben von Hanna Mittelstädt und Klaudia Ruschkowski, mit einem
Nachwort von Klaudia Ruschkowski, Edition Nautilus, Hamburg 2019
Schreiben ohne Geländer‘ möchte man dem literarischen Werk Etel Adnans, Malerin, Philosophin und Dichterin, in Anverwandlung von Hannah Arendts
Diktum „Denken ohne Geländer“ bescheinigen – Arendts Metapher für wahrhaft freies Denken. Einer inneren Freiheit, die sich nicht zuletzt Adnans Wurzeln in
unterschiedlichen Kulturen verdanken mag. Geboren 1925 in Beirut († 2021, Paris), war sie das einzige Kind einer griechischen Mutter und eines syrischen Offiziers. Während in der Familie türkisch
und griechisch,
ansonsten arabisch gesprochen wurde, war die Sprache auf dem
katholischen Gymnasium wiederum französisch. In vielem „unfreiwillig Pionierin“, wie sie von sich selbst sagt, zählte sie zu den ersten jungen Frauen in Beirut, die
das Haus verließen, um zu studieren und zu arbeiten. 1949 erlaubte ihr ein Stipendium, ein Philosophiestudium abzuschließen, auf dem sie 1955 an der Harvard University, Berkley, aufbaute, um
danach an
verschiedenen US-amerikanischen Colleges zu unterrichten. 1972 kehrte sie nach Beirut zurück, arbeitete dort als Redakteurin, bis der Bürgerkrieg 1978 sie erneut zwang, das Land zu verlassen und nach Paris zurückzukehren, um fortan zwischen Paris und Sausalito, ihrem Wohnsitz in Kalifornien, USA, zu pendeln. In Adnans gesamtem Schaffen, durchdrungen von philosophischem Gedankengut ebenso wie vom Blick der Malerin auf die Welt, die Natur, ihrer Beschäftigung mit kosmischen Dimensionen, dem Blick der Dichterin und Literatin, scheinen sich die Grenzen der Wahrnehmung beständig zu verschieben. Nichts bei Adnan ist statisch, vielmehr in stetiger Bewegung begriffen. Und ein solcher Blick auf die sich uns bietenden komplexen Wirklichkeiten scheint umso mehr dazu angetan, an den Gitterstäben des in der Präambel konstatierten ‚menschlichen Loses der Gefangenschaft‘ zu rütteln, um die damit einhergehende Begrenztheit unserer Wahrnehmungsfähigkeit zu transzendieren. Eben dies ist das Verdienst von Adnans Werk, das unter die Oberfläche ins Herzzentrum unserer Existenz zielt, dabei um all das kreist, was uns im Innersten bewegt, wie Liebe und Schmerz, Wandel und Stille, Tod und Vergeblichkeit und Gott – aufgehoben in einem Alleins, das wir erahnen, zu dem wir aber nicht ohne Weiteres Zugang haben mögen. Die Schriften der Mystiker etwa zeugen von dieser „fundamentalen Einheit Liebe“ Leseprobe, auf die sich auch Adnan beruft:
„Aber was ist die Liebe? Und was geben wir auf, wenn wir sie aufgeben? Liebe lässt sich nicht beschreiben, man muss sie leben. Wir können sie leugnen, aber wir erkennen sie, wenn sie uns ergreift. Wenn etwas in uns sich unser Ich unterwirft. Gefangener seiner selbst, das ist der Liebende. Ein seltsames Fieber. Und es muss nicht unbedingt ein menschliches Wesen sein, das die Liebe hervorruft. Ein Sonderfall. Ja.“ Leseprobe
Es ist das Verdienst der Herausgeberinnen, der Verlegerin und Gründerin der Edition Nautilus, Übersetzerin und Autorin Hanna Mittelstädt, sowie ihrer Mitstreiterin Klaudia Rutschkowski, gleichfalls Autorin und Übersetzerin, aber auch Dramaturgin und Kuratorin, uns mit Sturm ohne Wind einen veritablen Querschnitt des literarischen Schaffens ebenso wie des (auto)biografischen Hintergrunds Adnans präsentiert zu haben. Dem herausragenden Nachwort Klaudia Rutschkowskis, exzellente Kennerin des gesamten Schaffens Adnans, wiederum verdankt sich die tiefe Einsicht in deren Werk und differenzierte Erhellung der darin enthaltenen poetisch-essayistischen Textvielfalt. So bemerkenswert wie immer wieder überraschend die einheitliche Sicht auf die Dinge des Lebens. Das Politische und das Private wie Betrachtungen der Natur sind darin ebenso präsent wie das scheinbar Banale, das sich bei näherer Betrachtung genauso gut als einzigartig erweisen kann. Um dies adäquat zur Sprache zu bringen, bedient sich Adnan souverän des poetischen Verfahrens des Stream of Consciousness in mimetischer Anverwandlung des Lebensflusses selbst, mal in ruhigerem Fahrwasser, des Öfteren aber in reißerischer Manier. In all ihren Ausführungen erweist sich Adnan als leidenschaftliche Anwältin für das Leben und entschiedene Gegnerin des Kriegs, was ihren Äußerungen dazu schmerzliche Aktualität verleiht:
„In der Dichte der Nacht fällt ein Engel herab, zum Zeugnis von Krieg, Verwirrung und Leid. (...) Die Brise erklimmt die Hügel, und der Krieg kehrt auf die Titelseite zurück.“ Leseprobe
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl.
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt der Edition Nautilus, Hamburg
Buchtipp des Monats Januar - Februar 2023

© Hartmut Fanger
Großer Geist im kleinen Nest – Von Schlegel bis Goethe – Wie Jena zum Zentrum der Romantik wurde.
Andrea Wulf: Fabelhafte Rebellen – Die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich, aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn, C. Bertelsmann-Verlag, München 2022
Erfahren Sie, wie Jena zum Zentrum der Romantik wurde, und lassen Sie sich von Andrea Wulfs Streifzug durch die Welt der umtriebigen jungen Romantiker, einer leuchtenden Phase voller Aufbruchsenergie, verzaubern. Vor der Folie der Französischen Revolution erleben wir so plastisch wie detailliert namhafte Schriftsteller, Philosophen und Dichter besagter Zeit und machen uns mit deren gesellschaftspolitisch umstürzlerischem Gedankengut vertraut. Gemeint sind in erster Linie die Gebrüder August Wilhelm und Friedrich Schlegel sowie Caroline Schlegel, aber auch Fichte, Novalis und deren Ziehväter Goethe und Schiller und viele mehr.
Dabei versteht es Wulf, den Leser mitten in die Jenaer „Romantiker-Szene“, wie wir heute sagen würden, und deren ‚wildes Treiben‘, als das es in der Jenaer Gesellschaft wahrgenommen wurde, hineinzuziehen. Und dies auf 525 Seiten mit einem über 100 Seiten umfassenden Anmerkungsapparat, Literatur- und Stichwortverzeichnis, teils farbigen Abbildungen und Karten. Obschon wissenschaftlich fundiert, ist das Ganze gut les- und nachvollziehbar!
So wird der Leser mit auf die Reise in eine andere Zeit, in eine andere Welt genommen, eine Welt der Kleinstaaten und absoluten Herrscher, in der es wahrlich schwer gewesen ist, das eigene Ich – postuliert vornehmlich von dem Philosophen Johann Gottlieb Fichte –zu entdecken und sich gegen jede Art von Obrigkeit und Willkür zu behaupten, die bei Verstoß in der Regel zu Zensur, ja gar Gefängnisaufenthalt führte. Allein in Jena scheint es ein wenig anders gewesen zu sein, denn nur dort soll es laut Schiller etwas mehr Freiheiten gegeben haben. Dies mag sich nicht zuletzt der Tatsache verdanken, dass es dort bereits seit dem 16. Jahrhundert eine Universität gegeben hat, die nach Wulf von vier sächsischen Herzögen kontrolliert wurde, von denen ‚keiner tatsächlich das Sagen hatte’, was den Professoren entsprechend Spielraum erlaubte.
Anderswo war es sehr viel strenger. Insbesondere Caroline Schlegel, geborene Böhmer, konnte ein Lied davon singen. Als Befürworterin der Revolution, unverheiratet und schwanger in der Festung Königstein inhaftiert, galt sie erst im Zuge der Heirat mit August Wilhelm Schlegel wieder als gesellschaftsfähig. Spannend und mit Verve, wie in einem Roman, erzählt Wulf die außergewöhnliche Geschichte von Caroline Schlegel und kristallisiert dabei plastisch die Rolle der Frau in der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts heraus. Denn Caroline Schlegel war es auch, die entscheidend bei der bis heute gültigen Übersetzung ihres Mannes der Werke Shakespeares mitwirkte. Doch verfasste sie obendrein eigene literarische Texte. Allerdings blieb sie dabei, wie im Übrigen die meisten ihrer schreibenden Zeitgenossinnen, anonym oder deren Texte erschienen unter männlichem Namen. Frauen hatten in der Literatur kaum Rechte ebenso wenig wie im richtigen Leben, sollten sich allenfalls, amtlich verfügt, um die Familie kümmern.
Was für eine Zeit des Aufbruchs, alte Strukturen lösten sich auf und ein gewaltiger Wissensdurst brach sich wiederum Bahn. Es entstand eine Bewegung, in der die Jugend und als einzige Ausnahme der schon leicht betagte Goethe als ‚Gott’ gefeiert wurde. Schiller hingegen geriet mitunter in Konflikt mit Mitgliedern der Bewegung. So zum Beispiel mit Friedrich Schlegel, der dessen Zeitschrift, „Die Horen“, ‚als verstaubt‘ attackierte. In Berlin gab er schließlich unter dem Namen „Athenäum“ ein eigenes revolutionäres Blatt heraus, das neben einer umfangreichen Besprechung von Goethes „Wilhelm Meister“ vornehmlich von Novalis als „Blüthenstaub bezeichnete Fragmente enthielt, die einem neuen Genre entsprachen, was wiederum ebenso eine „Revolution der Worte“ beinhaltete. Doch war es auch der Beginn der napoleonischen Kriege, deren Gefahr zunächst unterschätzt wurde.
Dem Leser fällt es letztendlich nicht leicht, von der Lektüre zu lassen, bietet sie doch eine Fülle teils spektakulärer Informationen, die einerseits ein lebendiges Bild des späten 18. Jahrhunderts vor Augen führen, andererseits jede Menge überraschender Momente enthalten, die angesichts der oft skandalösen Verhältnisse nicht selten der Komik entbehren, uns ein Lächeln entlocken oder den Atem anhalten lassen. Am besten, man liest das Buch gleich ein zweites Mal!
Doch lesen Sie selbst lesen Sie wohl!
Für das Rezensionsexemplar bedanken wir uns herzlich beim C. Bertelsmann Verlag.
Buchtipp des Monats November 2022

© Hartmut Fanger:
KORRUPTION IN KASACHSTAN
Norris von Schirach: Beutezeit,
Penguin Verlag, München 2022
Der Folgeroman seines überaus erfolgreichen Debuts „Blasse Helden“ von Norris von Schirach alias Arhur Isarin spielt im Brennpunkt der Ereignisse am Kaspischen Meer mitten in Zentralasien, sprich Kasachstan. Temporeich, brisant und nicht ohne überraschende Momente, die unter die Haut gehen. Das Ringen der Supermächte Russland und China mit dem Westen um Bodenschätze und Macht liest sich von Grund auf packend. Und wie schon in ‚Blasse Helden’ taucht der Autor auch hier tief in die Psychologie eines mehr oder weniger zerrütteten Landes im Umbruch ein. Und Schirach weiß, wovon er schreibt. Schließlich hat er Kasachstan Mitte der 90er Jahre mehrfach bereist. In einem Interview äußerte er sich über die seiner Meinung nach ‚irrwitzige Korruption’ und permanente ‚Regierungskriminalität.’ Stoff genug, um daraus einen so ereignisreichen wie spannenden Roman zu machen. Dabei kommen nicht zuletzt die starken Kontraste eines Landes zum Tragen, in dem sich nach Solschenizyn der wohl größte Gulag der einstigen UDSSR befunden haben soll. Schlimmer noch: die über einhundert oberirdischen Atomtests. Das Ganze vor dem Hintergrund so krimineller wie reicher Clans und einer verarmten Bevölkerung. Nichtsdestotrotz soll gerade dort das Leben pulsieren, zumal in der Hauptstadt Almaty.
Eben dies bildet – wie auf einer Großleinwand – die Folie einer auf weite Strecken hin atemberaubenden Handlung. So erhält der Anfang vierzigjährige, wohlhabende deutsche Protagonist Anton, der mit der Machtübernahme Putins im Jahre 2000 gerade erst aus Russland geflohen war, eines Tages den Auftrag, in besagtem Kasachstan einen Stahlkonzern aufzuziehen. Helfen tun ihm drei Frauen: Anwältin Mira, die Chinesin Xenia und die aus Usbekistan stammenden Alisha. Dabei macht das ungleiche Team von Beginn an einschlägige Erfahrungen mit besagten Clans, die nach dem Ende der Sowjetunion ihre Vormachtstellung und erbeuteten Ländereien ohne Skrupel und in aller Härte verteidigen. Erschwert wird das Unternehmen zu allem hin im Zuge der Katastrophe von Nineeleven. Bezeichnend, dass sich seitdem zwar an dem Sumpf von Korruption nichts verändert, Gewalt allenfalls noch zugenommen hat. So erfährt Anton von einem ihm noch aus Sowjetzeiten bekannten Banker, dass es die Amerikaner sind, ‚die Druck aufbauen, und er froh sei, dass er keine saudischen Klienten hätte’. Andererseits tätigt man weiterhin Geschäfte mit Russland, etabliert Briefkastenfirmen und fälscht Frachtdokumente. Dabei handelt es sich am Ende um Summen, für die „sich die Gründung einer eigenen Bank in Liechtenstein“ lohnen würde.
Ein durchweg lesenswerter Roman, der in dunklen Novemberstunden spannende Unterhaltung brisanten Inhalts und Action bietet. Zugleich bringt er uns jedoch auch eine ferne, auf den ersten Blick exotisch anmutenden Region nahe. Auf den zweiten Blick wiederum erscheint Letztere in Anbetracht hautnaher Schilderung harter Wirklichkeiten im Zuge von Globalisierung und Internet recht nah. Desillusionierend nicht nur für Romantiker, wie von Hauptfigur Anton verkörpert. Am Ende wird dem Leser tiefer Einblick in ein bis dato weitgehend fremdes Land im weltpolitischen Kontext gewährt, und das nicht zuletzt im Hinblick auf das Russland Putins.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl
Für das Rezensionsexemplar danken wir dem Penguin Verlag herzlich!
Buchtipp des Monats Oktober 2022

© Hartmut Fanger
So märchenhaft wie brisant: Der neue Öko-Roman
Ulla Hahn: Tage in Vitopia, Penguin Verlag, München 2022
Angesichts all der Bedrängnisse, die derzeit unseren Alltag beschweren, kommt das neueste Werk von Ulla Hahn, nicht zuletzt im Hinblick auf die Klimakrise, gerade zur rechten Zeit. Der 249 Seiten umfassende Roman entwirft eine Zukunftsperspektive und macht Mut! Dabei unterscheidet er sich wesentlich von den früheren, autobiographischen Romanen der Autorin. Man erinnere sich nur an die von Erfolg gekrönten Spiel der Zeit, Das verborgene Wort oder Wir werden erwartet. Tage in Vitopia hingegen – erzählt aus der Perspektive der Eichhörnchen Wendelin Kretschnuss und Muzzli, geborene Coco von Hazelpusch – wäre eher dem Genre „Öko-Märchen“, in weiterem Sinne dem Begriff „Nature Writing“ zuzuordnen.

Ulla Hahn fesselt vom ersten Satz an, entfacht die Neugier des Lesers. Dabei geht es um nichts weniger, als die Welt zu retten. Denn die Eichhörnchen haben erkannt, was so manchem Erdenbürger noch nicht eingeleuchtet hat: Der Mensch selbst ist es, der gerade dabei ist, den Planeten Erde um seine Existenz zu bringen, insofern befinden sich sämtliche Lebewesen in der derselben bedrohlichen Lage.
Die Schilderung der Naturzerstörung im Hambacher Forst auf einem Kongress im fiktiven Land Vitopia, an dem geistreiche Lebewesen, sowohl aus vergangenen wie gegenwärtigen Zeiten, teilnehmen, bringt dies hier sehr genau auf den Punkt. So erläutern es etwa, jeweils aus ihrer Sicht, der Evolutionstheoretiker Charles Darwin aus dem 19. Jahrhundert oder auch der renommierte Wissenschaftler und in diesem Jahr verstorbene Naturschützer James Lovelock sowie Vertreter etlicher Tierarten. Gemeinsam wollen sie für ein friedliches und gerechtes Miteinander sorgen. Nicht zuletzt übrigens in Kooperation mit der ‚neuen Weltbewegung’ „Fridays for Future“.
Und wie in den vorhergehenden Romanen Hahns erfüllt auch hier das Gedicht seine spezifische Funktion. Zum einen finden sich dort zahlreiche Verse, zum anderen wird dem Eichhörnchen das Schreiben von Gedichten nahegebracht, was gewiss nicht nur manchem Leser, der selber gerne Gedichte schreibt, Vergnügen bereitet. Wie es überhaupt immer wieder um das Schreiben geht. Nicht umsonst heißt ein Kapitel zum Beispiel „Charles Darwin liebt Gedichte und seinen Großvater“, ein anderes, in Anlehnung an Goethes Autobiographie, „Dichtung und Wahrheit“.
Von der Lyrik nicht weit entfernt die Musik, die ebenfalls ihren Stellenwert in dem Roman einnimmt. Tage in Vitopia, voller melodischer Anklänge, sind angereichert mit Zitaten der schönsten Lieder unseres Kulturkreises – etwa Franz Schuberts „Forellen-Quintett“, Beethovens „Ode an die Freude“, Louis Armstrongs „What a wonderful World“ oder Bob Dylans, „The Times, they’re achanging“, der nach Ulla Hahn bzw. Wendelin Kretschnuss ‚mit Friedrich Schiller den Stein ins Rollen bringt’. Dementsprechend auch Kapitelüberschriften wie „Auf dem Klingstein-Berg“ und „Abstieg vom Klingstein-Berg“. Unterstützt von besagten Gedichten, Liedern und Hymnen, schwingt und klingt er in seinem eigenen Rhythmus. Nicht zuletzt verweist es auf den ganzheitlichen Impetus des Romans, wenn neben dem berühmten ‚Geh aus mein Herz und suche Freud“ von Paul Gerhardt, der ‚Hymnus an die Mutter Erde’ aus dem ‚Atharva Veda’ oder das fünfzeilige japanische ‚Tanka’ zitiert und erläutert wird.
Ein Buch, das trotz aller Bedrohungsszenarien positiv in die Zukunft weist. („Wir schaffen das!“) Und nicht von ungefähr wird im letzten Drittel mit den Worten „Freuet euch!“ dazu aufgefordert‚ ‚den Dichtern zu vertrauen’. Dazu das treffende Zitat aus der „Patmos“ Hymne Friedrich Hölderlins: „Wo aber Gefahr ist, wächst/Das Rettende auch“, Worte, die Trost spenden und in Anbetracht der bevorstehenden dunklen Tage Licht hineinbringen mögen.
Denken wir ruhig schon jetzt an Weihnachten. Tage in Vitopia ist jedenfalls ein Buch, dass auf jeden Gabentisch gehört!
Aber lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein
Rezensionsexemplar gilt dem Penguin Verlag!

Buchtipp des Monats
September 2022
© Hartmut Fanger
Starke Frauen in einem schwachen Sozial- und Bildungssystem
Giulia Caminito: Das Wasser des Sees ist niemals süß, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2022
Mit dem 320 Seiten umfassenden Adoleszenz-Roman „Das Wasser des Sees ist niemals süß“ ist der vornehmlich in Italien bekannten Schriftstellerin Giulia Caminito auf Anhieb ein Bestseller gelungen. In über zwanzig Sprachen übersetzt, wird er demnächst in zahlreichen weiteren Ländern, wie u.a. Griechenland und Japan erscheinen.
Vielfach ausgezeichnet erzählt der dritte Roman der Autorin von den Hindernissen ihrer Generation, am sozialem Aufstieg zu partizipieren, sowie der zunehmender Radikalisierung der Protagonistin im Zuge dessen Ein Roman von erzählerischer Wucht, den man, einmal zu lesen begonnen, nicht mehr aus der Hand legt. Ebenso wenig wie man die Protagonistin und Ich-Erzählerin so schnell wieder vergisst. Zwar wächst sie an der Peripherie Roms auf, hat aber ‚das Zentrum nie gesehen‘. Weder das Kolosseum noch die Sixtinische Kapelle, von Vatikan oder Villa Borghese ganz zu schweigen. Aus ärmsten Verhältnissen stammend, radikalisiert sie sich zunehmend, was ihr durchaus dienlich ist, sich in der Schule und später als Doktorandin an der Universität durchzusetzen.

Arm sein heißt hier nicht, sich in die Opferrolle zu be- und am Ende angesichts der fatalen gesellschaftspolitischen Vorgaben aufzugeben. Im Gegenteil, macht die Protagonistin ihrem aus der griechischen Mythologie entlehnten Namen „Gaia“ alle Ehre, gilt dieser doch als Bezeichnung der Erde als erster Gottheit und wird zugleich als „Die Gebärende“ gedeutet. Damit wird überdies auf die herausstechenden weiblichen Aspekte der Protagonistinnen, Mutter und Tochter, verwiesen, die über charakterliche Stärke und Selbstbewusstsein ebenso verfügen wie einen rebellischen, unbeugsamen Geist. So etwa, wenn sich die Mutter, als Anwältin verkleidet, aus dem Wohnungsamt so lange nicht fortbewegt, bis sie von den Sicherheitsleuten unter Anwendung von Gewalt hinausgeworfen wird. Die Tochter, zugleich Ich-Erzählerin, wiederum zertrümmert einem Mitschüler, der sie unentwegt mobbt und ihren Tennisschläger kaputt macht, das Knie. Besagter Tennisschläger gewinnt umso mehr an Bedeutung, wenn wir erfahren, welche Entbehrungen Gaias Familia auf sich genommen hat, ihr diesen zu finanzieren. Die Mutter als Putzkraft tätig, der Vater Invalide, hausen sie mit fünf Personen in einer zwanzig Quadratmeter Kellerwohnung, die Zwillingskinder schlafen in Pappkartons ...
Spannend zu allem hin das Verhältnis zwischen Gaia und ihrer angesichts der Verhältnisse schon zwangsläufig pragmatischen Mutter, die Gaia kaum erträgt, und die sie dennoch, wo es nur geht, unterstützt. An einer Stelle heißt es, dass Gaia ‚über sie richtet und ihr nicht vergibt.“ Markant erweist sich die Hassliebe zwischen Mutter und Tochter, indem Erstere den 18. Geburtstag ihrer Tochter in dem Fitnessstudio ausrichtet, in dem sie putzt. Das Ganze endet dann auch in einem Debakel. Das von der Mutter ausgesuchte Kleid, Schuhe und Frisur kommen bei Gaia nicht gut an, der Vater, der das Haus ewig schon nicht verlassen hat, erleidet in seinem Rollstuhl auf dem Weg dorthin Angstattacke auf Angstattacke.
Deutlich wird, wie schwer es ist, über den eigenen Tellerrand zu schauen, zumal wenn der Alltag sich als ständiger Existenzkampf gestaltet. So ist für die Analyse, was die Politik bewirkt und den unzulänglichen sozialen Rahmen, den sie liefert, kaum Raum, geschweige denn für entsprechendes Engagement. Eine treffende Metapher hierzu bildet der Moment, wo der Hubschrauber über dem See abstürzt, dies jedoch keinen interessiert.
Aber lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für das uns freundlicherweise überlassene
Rezensionsexemplar gilt dem Klaus Wagenbach
Verlag!

Buchtipp des Monats August 2022 - September
© erf:
Zwischen Selbstreflektion und Klage
Josefine Klougart: New forest, Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2022 (Kopenhagen 2016), aus dem Dänischen von Peter Urban-Halle.
Dies so opulente wie umfangreiche Werk – über 500 Seiten – aus der Feder der gefeierten dänischen Autorin verfehlt auch diesmal nicht den Sog, mit dem sie schon die Leser:innen ihres ersten, ins Deutsche übersetzten Romans, Einer von uns schläft (2019) , in den Bann zog. Dies mag sich nicht zuletzt dem Facettenreichtum ihres Wahrnehmungsspektrums verdanken. Neben ihren literarischen Ambitionen ist Klougart in der Musik ebenso zuhause wie in der Malerei, was offenbar einen immensen Reichtum in der Rezeption all dessen befördert, was der Erzähl-Stimme im wahrsten Sinne des Wortes zustößt.
Überdies fungiert immer auch die Natur als Folie des Erzählens, was zusätzlich seine Magie ausmacht.
Im Übrigen folgt Klougart keiner Chronologie, als sie uns vielmehr nach Art des Stream of Consciouness assoziativ in Erinnerungsbilder eintauchen lässt. Ebenso wenig, wie sie durchgehend an einer Erzählperspektive festhält, so kippt die Ich-Stimme bisweilen durchaus in die Distanz wahrende dritte Person. Anlass der Erkundung des eigenen Innenraums ist eine gescheiterte Beziehung, wonach sich die Protagonistin allein mit ihrem Hund aufs Land zurückzieht. Steht zunächst das qualvoll gezeichnete Ende der Beziehung zu dem einstigen Lebensgefährten im Zentrum ihrer Selbsterforschung, münden des Weiteren ihre Gedanken zunehmend in die Welt ihrer Kindheit und Jugend. Dabei kommt die konfliktive Beziehung zu ihren Eltern ebenso zur Sprache wie das von Eifersucht geprägte Verhältnis zu der Schwester. Im Grunde wird das gesamte bisherige Leben auf den Prüfstand gestellt, Wünsche, Träume, nicht zuletzt die Reisen der Protagonistin, stehen Letztere doch für Aufbruch und Weitung des Blicks, worum es in diesem Art Prosa-Poem, getragen von Sprachrhythmus und Wortklang, vornehmlich geht. So streifen wir mit ihr ihre Heimat Jütland, die norwegischen Lofoten, stranden schließlich im griechischen Thira. Am Ende ist es der New Forest, Südengland, in dem Kindheitserinnerungen gespeichert sind.

Traumwandlerisch anmutend, werden hier Abschied und Tod, Trauer und Verlust, Scham auch, poetisch durchdekliniert und in ein funkelndes, bisweilen mit schwarzen Diamanten bestücktes Textgewebe gewandelt. Und doch sei, bei aller Sprachvirtuosität, bei allem Wohlklang, der dem Text eingewoben ist, der Einwand erlaubt: Weniger wäre auch hier mehr gewesen, wie oben erwähnt, immerhin über 500 Seiten ohne Anhaltspunkte im Rahmen eines Handlungsstrangs. Nichtsdestotrotz – ein in schillernden Bildern dahinfließender Erzählfluss, gespeist von Farben und Licht, mal vom Entzücken über Naturschönheit, mal von Melancholie getragen, angesichts letztendlich der Vergeblichkeit menschlichen Strebens. Ein Diskurs, der den Leser, der sich darauf einlässt, selbst auf langer Strecke zu tragen vermag.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Martthes & Seitz Verlag!

Buchtipp des Monats August 2022
© Hartmut Fanger
Geburtenstarke Jahrgänge in der BRD – Sind wir noch zu retten?
Thomas E. Schmidt: Grosse Erwartungen. Die Boomer, die Bundesrepublik und ich, Rowohlt Verlag, Hamburg 2022
In dem autobiographischen Essay gelingt es Thomas E. Schmidt, seines Zeichens Autor, Publizist und Kulturkorrespondent der Wochenzeitschrift DIE ZEIT, als Zeitzeuge auf 265 Seiten in 12 Kapiteln die wesentlichen Aspekte besagter geburtenstarker Generation vor Augen zuführen. Sprachlich versiert, lesenswert und facettenreich.
Als Zugehöriger derselben sorgt der Autor nicht zuletzt mit der Einführung des ‚Ichs’ sowie des ‚Wir’ für eine besondere Nähe zu den Ereignissen. Von historischen Gegebenheiten, wie etwa dem Leben in den Ruinen des Zweiten Weltkrieges, gefolgt von Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, bis hin zur Wiedererlangung der Deutschen Einheit und Gegenwart. So erlebte er in den Sechzigern und Siebzigern die zunehmende Politisierung in Schule und Universität, wo laut Schmidt „der real existierende Neomarxismus ...Anlass zu weiterführenden intellektuellen und politischen Suchbewegungen [gab].“ Aus der Frankfurter Schule mit Horkheimer und Adorno ging schließlich die Apo hervor, und entgegen deren geistige Väter war Revolte angesagt, die im sogenannten „Establishment“ nicht zuletzt Debatten über die Länge der Haare entfachte, worunter auch der Ich-Erzähler zu leiden hatte. Aus den USA nahmen seit den Sechzigern Literaturen der Beat-Generation wie Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs, um nur einige zu nennen, ihren Einfluss. Hesses Steppenwolf avancierte, ähnlich wie Adornos einst im amerikanischen Exil verfasstes Minima Moralia – Reflexionen aus dem beschädigten Leben, diesseits und jenseits des großen Teichs jeweils zum Kultbuch. Auf der politischen Bühne wiederum ging mit dem Kniefall von Warschau der Stern Willy Brandts auf. Andererseits hielt die zunehmende Gewaltbereitschaft der RAF die Nation ebenso in Atem wie die Musik von „Velvet Underground“.
Doch wie erklärt sich dann später, in den Neunzigern und während der Anfänge des 21. Jahrhunderts, das Verhältnis besagter Geburtengänge zu dem ehemaligen Kanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder, dem Schmidt ein ganzes Kapitel widmet. Wobei er originelle Titulierungen und Vergleiche nicht scheut, etwa wenn er Schröder in den 90ern als „Soul Foot für die Seele“ („endlich kein Vater mehr“) bezeichnet und ihn zur Zeit, als dieser noch Ministerpräsident in Niedersachen war, als ‚machtbewussten Herzog in der Provinz, ein Buckingham, den Heinrich VIII mit Argwohn beobachtete und ihn am liebsten aufs Schafott geschickt hätte’ darstellt. Für viele entsprach Schröder laut Schmidt „womöglich wirklich dem Typus des Halbstarken aus unserer Kindheit, und dass etwas Raues, Widerborstiges, Plebejisches in die Politik einzog ... “
Kritiker von Schröders Politik, vornehmlich der von ihm ins Leben gerufenen Agenda 2010, danach seiner Rolle als Wirtschaftslobbyist russischer Gaskonzerne, nicht zuletzt der Freundschaft zu Putin, zumal seit dem Ukraine-Krieg, vermag dies Kern-Kapitel wenig zu überzeugen. Hinzu kommt der nicht wirklich glückliche Genre-Mix zwischen den romanhaften Zügen des Werks, gepaart mit essayistischen Anteilen.
Nichtsdestotrotz eine den Zeitgeist treffende und allein schon von daher empfehlenswerte Lektüre. Zugleich so kenntnisreiches wie farbiges Dokument einer Epoche, in dem sich so mancher wiederfinden dürfte. Darin eine Fülle von Anregungen, die zur Diskussion einladen. Ein streitbares Buch. Nicht zuletzt im Hinblick darauf, dass besagte Generation mit ihrem Verschleiß an Ressourcen künftigen Generationen ein schweres Erbe hinterlassen hat.
Doch lesen Sie selbst. lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt Verlag in Hamburg

Buchtipp des Monats Juli 2022
© Hartmut Fanger
Von Verlust und kleinen Fluchten
Helen Frances Paris: Das Fundbüro der verlorenen Träume, Übersetzung aus dem Englischen von Sophie Zeitz-Ventur, dtv, München 2022
Dieses Roman-Debut von Helen Frances Paris – einstige Professorin für Theaterwissenschaften an der Stanford University in Kalifornien, britische Autorin und Leiterin des Londoner Theater Curious, überdies preisgekrönte Lyrikerin – ist ein richtiges Sommerbuch voller Leichtigkeit und Zauber – nicht ohne Tiefgang.
So überzeugt die Hauptfigur und Ich-Erzählerin Dorothea, genannt Dot, durch ihre Empathie und Mitmenschlichkeit. Hintergrund des Romans bilden der
unwiederbringliche Verlust des geliebten Vaters, das Gefühl von Verrat und Schuld sowie das Nachlassen des Gedächtnisses der schwer an Demenz
erkrankten Mutter, von der verhassten Schwester einmal ganz abgesehen, weshalb sich die Protagonistin in den Kammern des Fundbüros, dem sie vorsteht, förmlich vergräbt. Von hier aus hat sie
genügend Spielraum, kann sie wirken, kann für Ordnung sorgen und so manchem Geheimnis nachgehen. Zugleich ist es für sie aber auch ein Prozess der Selbstfindung.

Letzteres bildet schließlich auch das tragende Element des 368 Seiten umfassenden Werks. Nicht von ungefähr verliert sich die Ich-Erzählerin in den Katakomben besagten Fundbüros, übernachtet dort heimlich und verstößt gegen all die ihr auferlegten Regeln, indem sie die verlorengegangenen Gegenstände für sich selbst beansprucht. So betrinkt sie sich mit einem im öffentlichen Verkehrsmittel vergessenen Absinth, ernährt sich aus den dort abgestellten Dosen mit Pflaumen und Obstsalat, veranstaltet für sich allein eine kleine Modenschau, indem sie die feinsäuberlich archivierten Kleidungsstücke probiert. Begleitet vom Sound der Bee Gees und deren ‚Stayin’ Alive’, entflieht sie so der als unerträglich empfundenen Realität. Alles scheint indessen in Auflösung begriffen, das Haus der Mutter soll zu allem hin verkauft werden.
Umso anrührender, wie sich Dorothea um die verlorenen Dinge kümmert – „Rucksäcke, Schals, Regenmäntel, Brillen, Bücher, das Hochzeitskleid, der Waschbeutel“ Leseprobe: „Alles verloren, verlassen, vergessen. Aber das ist nicht so schlimm, denn ich bin ja da, verteile Anhänger, kümmere mich um sie.“ Leseprobe Darüber hinaus hervorzuheben sind die detailgenauen Schilderungen der Gegenstände, wenn die Autorin zum Beispiel die hölzernen Griffe der archivierten Schirme beschreibt und das, was ihre Protagonistin damit in Verbindung bringt. So heißt es an einer Stelle, dass diese bunten Schirme Dorothea „an einen Schwarm tropischer Waldvögel mit exotischem Gefieder“ erinnern, „Violett, Smaragd, Saphir, Türkis“ Leseprobe, an „einen Rotnacken-Topas, einen rotschnäbligen Wimpelschwanz, einen saltoschlagenden Rubinkehlkolibri“ Leseprobe, was im wahrsten Sinne des Wortes Farbe hineinbringt. Wie in den Augen der Protagonistin überhaupt ‚all die im Neonschein leuchtenden vergessenen Dinge lebendig werden’:
„»Heute seid ihr nicht verloren und allein«, verkündet sie mit ausgebreiteten Armen. »Ich adoptiere jede fröstelnde Socke, jedes zurückgelassene Buch und jeden lieben Pullover. Ich nehme euch unter meine Fittiche.« Alles um mich herum pulsiert vor Lebendigkeit.“ Leseprobe
Ihr geheimes Leben im Fundbüro geht bis zu dem Moment gut, wo sie von ihrem Vorgesetzten sexuell belästigt und aufgrund ihrer Verweigerung gekündigt wird. Von nun an scheint sie auf verlorenen Posten. Doch eine Angelegenheit will sie noch regeln. Es geht um eine honigbraune Reisetasche, die sie mit dem detektivischen Feingespür eines Sherlock Holmes und dessen Dr. Watson ihrem Besitzer zurückbringen will. Doch bis es so weit ist, gilt es noch so manches Abenteuer zu bestehen.
Schwerlich kann man sich dem Zauber des Buches, dem dort zur Sprache gebrachten schillernden Ambiente und der Liebenswürdigkeit der Protagonistin von der ersten Seite an bis zum Schluss entziehen.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Deutschen Taschenbuch Verlag dtv Archiv

Buchtipp des Monats Juli 2022
© erf
En la Tarde de la Vida te examinarán en el Amor
Am Abend des Lebens wirst du in der Liebe geprüft
Juan de la Cruz (1542-1591), spanischer Mystiker
Von einem, der auszog,
sich kennenzulernen
Emmanuel Carrère: Yoga, Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2022 (Paris 2020), aus dem Französischen von Claudia Hamm
Emmanuel Carrère, schillernde Figur im französischen Literaturbetrieb, ist als unermüdlich Sinnsuchender spirituellen Pfaden auf der Spur, wobei er als autofiktionaler Autor in der Tradition einer Annie Ernaux die Leser unmittelbar an seinen Erfahrungen teilhaben lässt. So etwa in „Das Reich Gottes“ (Berlin 2016, frz. „Le Royome“, Paris 2014), wo er den Wurzeln christlicher Spiritualität nachspürt. Seit Jahren meditierend, und überzeugt von diesem Weg der Selbstfindung, hat er 2015 vor, darüber ein feines kleines Büchlein zu schreiben, und besucht eigens dazu ein zehntägiges Schweige-Retreat in einem Meditationszentrum, um in vollständiger Isolation, abgeschnitten von der Außenwelt, an einem Vipassana-Kurs, einer besonders strengen Form der Meditation, teilzunehmen, wo es darum geht, ‚die Dinge zu sehen, wie sie sind‘. Doch statt eines schmalen Büchleins, ist daraus ein 341 Seiten starker Roman geworden, zwar gleichwohl über Yoga, darüber hinaus wird darin jedoch die Geschichte einer schweren existenziellen Krise des Autors erzählt. Auslöser war die jäh in besagtem Retreat ihn ereilende Nachricht über die Ermordung eines Freundes bei dem Attentat auf Charlie Hebdo, zu dessen Trauerfeier er einen Beitrag beisteuern sollte. Doch nicht nur das, hat sich offenbar auch seine Frau von ihm scheiden lassen, was jedoch insofern als Leerstelle in das Buch einfließt, als diese ihn vertraglich dazu verpflichtet hat, sie nicht als literarische Figur in seinen Texten zu verwenden. Im Zuge all dessen erleidet der Ich-Erzähler eine Bipolar-Störung und wird in deren Folge mit einem Zusammenbruch in die Pariser Nervenklinik Sainte-Anne eingeliefert, wo er vier Monate verbringen soll und, selbstmordgefährdet, mit Elektroschocks behandelt wird.
Danach will er sich in seinem Haus auf einer der griechischen Inseln erholen. Als auf der Nachbarinsel Leros syrische Flüchtlinge eintreffen, engagiert er sich dort, indem er Geflüchtete unterrichtet, wobei sich sein persönliches Leid mit dem der auf Leros Gestrandeten allein schon insofern heilsam überlagert, als man in solidarischer Manier gemeinsam konkrete erste Schritte in ein lebenswertes Leben tut.

Abschließend würdigt Carrère in liebevollem Angedenken seinen langjährigen Verleger und Freund Paul Otchakovsky-Laurens († 2018), einen Literatur Verliebten, der, als ein Zufall ihm offenbart, dass Carrère sein gesamtes Werk mit dem rechten Zeigefinger getippt hat, der Erheiterung und des Erstaunens darüber nicht müde wird. Im Übrigen geht es um den Prozess der Realisierung des Buchprojekts Yoga, das sich so ganz anders entwickelt hat, als ursprünglich geplant. Gespickt mit manch existenzieller Erkenntnis, wie etwa „Niemand konnte sich in meine Liebe betten, und auch ich werde mich in niemandes Liebe betten können“.Leseprobe
Die Stärke des Textes, der durch seine Aufrichtigkeit bis zur Schmerzgrenze besticht, besteht nicht zuletzt in der Distanz des Autors zu sich selbst, die es ihm erlaubt, sich einer so präzisen wie ausdifferenzierten Selbstanalyse zu unterziehen, mit Sinn für Selbstironie und Humor. Überdies ist sein Erzählfluss von einem brennenden, quicklebendigen Erkenntnisinteresse inspiriert, das den Leser mitreißt. Carrère weiß, wovon er schreibt. Sei es im Hinblick auf Yoga, Meditation, spirituelle Belange überhaupt, sei es im Hinblick auf das Leiden an der eigenen Person, das schließlich im Zentrum der Auseinandersetzung mit sich, dem Leben, der Liebe und, last but not least, dem Schreiben steht. ies immer vor dem Hintergrund der ursprünglich von Pythagoras gestellten Frage „Wozu ist der Mensch auf Erden“, der diese einst lapidar mit ‚um den Himmel zu betrachten‘ beantwortete.
Carrères Freund und spiritueller Wegbegleiter seit Jahrzehnten, Hervé Clerc – wie er Journalist und Buchautor –, ist wiederum von dem Gedanken beseelt, dass es um mehr, nämlich darum gehe, einen Ausweg aus dem irdischen Schlammassel zu finden, man sich dabei nur an die von Vorbildern erstellten ‚Landkarten‘ halten müsse, die dies schon vor uns erforscht hätten, wie „Platon, Buddha, Meister Eckhart, Teresa von Ávila oder Patanjali*“ Leseprobe. Bereits in drei Büchern ist Clerk indessen der Frage nachgegangen, „was die Mystiker über jene letzte Wirklichkeit gesagt haben, die lange mit einem Decknamen bezeichnet wurde, der uns nicht mehr so recht zusagt: Gott“ Leseprobe. Carrère widerspricht dem Freund nicht, bleibt aber, im Gegensatz zu diesem, der von einer möglichen Lösung der augenscheinlichen Aporien der Conditio humana ausgeht, skeptisch. Und man fragt sich angesichts des Zusammenbruchs, den er erleidet, ob ihm diese Skepsis, die sich nicht zuletzt seiner hohen intellektuellen Kapazität verdanken mag, alles zu hinterfragen, zugleich auch zum Verhängnis geworden ist.
Insgesamt versteht es Carrère vielleicht wie kein anderer, eine unwiderstehliche Intimität zwischen Autor und Leser herzustellen, so etwa auch, wenn er gegen Schluss, in Anverwandlung eines russischen Abschiedsrituals, kundtut:
„Ich würde (...) mich [gern] von diesem Buch verabschieden und uns viel Glück wünschen, ihm, mir und dir, lieber Leser. Sobald die letzte Seite umgeschlagen sein wird, was nicht mehr lange dauern kann, könnten wir uns eine Minute lang miteinander hinsetzen. Die Augen schließen, schweigen, ein Weilchen still sein. (...)“ Leseprobe
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
* Indischer Gelehrter und Verfasser des Yogasutra, klassischer Leitfaden des Yoga, weshalb er als „Vater des Yoga“ gilt. Soll zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert vor Chr. gelebt haben. Quelle: Wikipedia
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Verlag Matthes & Seitz Archiv
Buchtipp des Monats Juni 2022
© Hartmut Fanger
Kinderverschickung auf Italienisch

Viola Ardone: „Ein Zug voller Hoffnung“ in der Übersetzung aus dem Italienischen von Esther Hansen, Bertelsmann Verlag, München 2022
Die 1974 in Neapel geborene Autorin Viola Ardone hat mit ihrem Roman „Il treno di bambini“ in Italien bereits vor zwei Jahren für eine kleine Sensation gesorgt und es mit über 200.000 verkauften Exemplaren bis ganz nach oben in die Bestsellerlisten geschafft. Inzwischen ist er in 30 Ländern erschienen. Dank dem Bertelsmann Verlag ist das von Esther Hansen exzellent übersetzte Werk unter dem Titel „Ein Zug voller Hoffnung“ nun auch deutschen Lesern zugängig.
Auf so anrührende wie teils humorvolle Weise erzählt die Autorin auf 284 Buchseiten von einer Initiative der politisch Linken in
Italien, die es unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ermöglicht hatte, Kinder für ein knappes Jahr aus dem Elend der verarmten südlichen Regionen zu befreien und mit dem Zug in den Norden zu
schaffen, um sie dort bei wohlhabenden Familien unterzubringen.

Anhand der Hauptfigur, dem siebenjährigen Amerigo Speranza, wird deutlich, wie wenig Chancen ein Kind in Italien im Jahr 1946 hatte, das in Armut aufwuchs, und was für Möglichkeiten sich eröffnen können, wenn gute Ernährung selbstverständlich und man materiell gut gestellt ist. Unumstößliche Tatsache, die bis heute ihr Gültigkeit nicht verloren hat. So blieben die Talente Amerigos, wie etwa ein Hang zu Zahlen und Mathematik, seinen Gönnern nicht verborgen. Wie er überhaupt auf vielen Ebenen gefördert und zum Beispiel auch an ein Musikinstrument wie die Geige herangeführt wurde. Faktoren, an die im Süden, wo es um das nackte Überleben ging, nicht zu denken war. Nach seiner Rückkehr unterschlägt die Mutter die an ihn gerichteten Briefe und die geliebte Geige ist eines Tages einfach verschwunden. In einem Akt kindlicher Selbstermächtigung haut er schließlich ab zu seinen Gönnern im Norden und macht fortan von dort aus seinen Weg.
Was wohl, stellt sich am Ende Amerigo die Frage, wäre aus ihm geworden, wenn er die Erfahrung im Norden nicht gemacht hätte. Vielleicht hätte er den Beruf des Schusters ergriffen. Denn für Schuhe hatte er sich von früh an interessiert, zumal er stets die seiner Vorgänger auftragen musste, die ihm folglich nicht passten, die drückten und schmerzten. Ein Schmerz, der ihm selbst noch nach über vierzig Jahren in Erinnerung ist, als er seinen Heimatort besucht.
Last but not least ein Buch, das nicht nur im Hinblick auf Konfliktkonstruktion und Figurenzeichnung, sondern auch aufgrund seiner sprachlichen Qualitäten ein pures Lesevergnügen ist. So wird zum Beispiel gekonnt mit Hilfe von Auslassungen ein Erzählfluss von enormer Dichte erzielt, dem man sich kaum entziehen kann. Behutsam wiederum die Einstreuung historischer, den Krieg betreffender Fakten. So geht es immer wieder um den Kampf gegen die nationalsozialistischen Deutschen, um Partisanen und Gefallene. Rundum ein lebenspralles Stück Literatur, das voll und ganz zu Herzen geht.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Archiv
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Bertelsmann Verlag
Zählt im Leben denn nur, was wir bekommen? Zählt nicht
unsere Sehnsucht, zählen nicht unsere Träume? Julia Holbe

Buchtipp April 2022
© Hartmut Fanger
Was zählt im Leben
Julia Holbe: „BOY MEETS GIRL“
Penguin Verlag, München 2022
Nach ihrem erfolgreichen Debut „Unsere glücklichen Jahre“ ist mit „boy meets girl“ bei Penguin nun ein weiterer vielversprechender Roman von Julia Holbe erschienen Auf über 283 Seiten erzählt die Autorin die Geschichte einer großen Sehnsucht sowie der Suche nach erfüllter Zweisamkeit, die die Protagonistin, Ich-Erzählerin und verheiratete Paartherapeutin Nora umtreibt. In Begriff, sich von ihrem untreuen Mann Paul zu trennen, sieht sie auch in einer Liaison mit ihrem ehemaligen Englischlehrer Gregory keine große Zukunft. Der einzige, den sie wirklich und von tiefstem Herzen liebt, ist ihr alter Freund Jann. Doch Letzterer steckt in einer festen Beziehung ...
Eine Misere. Zumal beide – augenscheinlich ‚nur’ gute Freunde – nicht wirklich voneinander loskommen, sich immer wieder über den Weg laufen. Stets kommt dabei der Zufall zur Hilfe. Beliebtes Instrument, die Handlung voranzutreiben, eine Geschichte mit einer überraschenden Wendung zu versehen, um den Leser in Schach zu halten, was Julia Holbe hier meisterhaft versteht. So begegnen sich die Figuren gleich zu Beginn nach vielen Jahren rein zufällig im Supermarkt wieder. Ein andermal zusammen mit den jeweiligen Partnern auf dem Weg zum Kino, was zu einem gemeinsamen Essen und – nicht ohne Humor – zu einer Fülle an Komplikationen führt. Wie das Ganze überhaupt spannend und unterhaltsam erzählt ist. Wobei stets die Frage im Raum schwebt, inwieweit sich die Liebe der Protagonistin zu ihrem Freund Jann doch noch erfüllen mag.
Kern- und Schlüsselsatz des Romans bildet zugleich der Titel „boy meets girl“, ‚Anfang aller zu erzählenden Geschichten‘ überhaupt, wie es gleich zu Beginn, aber auch gegen Ende des Romans heißt. So äußerte sich zumindest der berühmte US-amerikanische Filmemacher Alfred Hitchcock gegenüber seinem französischen Kollegen Francois Truffaut. Was sich schon insofern bestens mit dem Plot vermittelt, als seitens der ausgesprochen kinoaffinen Hauptfigur über den gesamten Roman verteilt von zahlreichen Filmklassikern die Rede ist. Eine Vorliebe, die sie mit dem von ihr begehrten Jann teilt.
Sehr gelungen überdies die Schilderung der Aufenthalte in dem kleinen, nicht weiter benannten und vom inneren Konflikt Noras beherrschten Ort am Meer. Letztendlich wünscht sich die Protagonistin eine Beziehung, die bis ins Alter anhält, was in den Figuren ihrer Eltern ein Spiegelung erfährt. So erschreckend wie anrührend die Passagen, wo die Demenz des Vaters immer deutlicher zutage tritt, die Mutter eine Herzoperation zu überstehen hat, wodurch das Ganze an Tiefe hinzugewinnt.
Alles in allem mit der feingesponnenen Handlung und den sympathischen Charakteren ein vielversprechendes Lesevergnügen.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem PENGUIN Verlag!

© Erna R. Fanger
Die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft ist nur ein hartnäckiger Eindruck. Albert Einstein
Von innen heraus erzählt
Jon Fosse: Ich ist ein anderer. Heptalogie III-V* Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Rowohlt Verlag, Hamburg 2022
In Ich ist ein anderer erzählt der vielfach ausgezeichnete Theaterautor und Romancier Jon Fosse in Anverwandlung des rimbaudschen Diktums von der Möglichkeit seines Ich-Erzählers Asle, zugleich er selbst sowie ein anderer zu sein. Aber die Identität des Ich-Erzählers schwankt nicht nur zwischen ihm und seinem Alter-Ego, das wie er Maler ist, jedoch im Gegensatz zu ihm erfolglos und dem Alkohol verfallen. Ein gefährdetes Alter-Ego, um das er sich kümmern, dem er beistehen muss. Schwankend ist gleichwohl die Identität des Asle der fiktiven Gegenwart und des Asle in der Erinnerung an das Kind und den Jugendlichen, wo er von sich in der dritten Person erzählt. Nicht zuletzt legt der Name seiner verstorbenen Frau Asel nahe, dass auch sie als Spiegelfigur angelegt ist, indem nur das L, statt hinter dem E, vor dem E platziert werden müsste, und ihr Name und der des Ich-Erzählers wären identisch. Sie ist es auch gewesen, die ihn veranlasst hat, zum Katholizismus zu konvertieren. Letzteres triff im Übrigen nicht nur auf den Ich-Erzähler zu, sondern auch auf den Autor selbst. Und so, wie sich unablässig Identitäten, Subjekt- und Objektebenen verschieben, sich gegenseitig aufzuheben scheinen und dann unverhofft die Richtung wechseln, überlagern sich gleichwohl die unterschiedlichen Zeitebenen. Fiktive Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft fließen übergangslos ineinander, bilden ein bewegtes Kontinuum jenseits der Chronologie der Ereignisse. Daraus erwächst ein Erzählstrom, in dem sich überdies die norwegische Landschaft mit einschreibt, in der der Ich-Erzähler aufgewachsen ist. Weitläufig, spärlich besiedelt – grandiose Kulisse einer mächtigen, verschneiten Bergwelt. Gleichwohl scheint wiederum den Erzähl-Rhythmus – nicht weniger mächtig im Kommen und Gehen seines Wellengangs – das Meer vorzugeben. Raum- und Zeitkontinuum fließen so unablässig ineinander. Die Chronologie der Zeit entbehrt jedweden Ziels, scheint somit aufgehoben. Ereignisse, Betrachtungen erfolgen scheinbar zusammenhanglos nebeneinander, versehen mit Rückgriffen auf Vergangenes, alles auf derselben semantischen Ebene. Desgleichen changieren die sichtbare und die unsichtbare Welt sowie das Diesseits mit seinen realen Figuren, mit denen der Ich-Erzähler in Verbindung steht, wie der Nachbar und Bauer Åsleik oder Galerist Beyer, der regelmäßig seine Bilder ausstellt, und das Jenseits, wo der Ich-Erzähler, umgeben von Engeln, mit seiner verstorbenen Frau im Gespräch ist, die er schmerzlich vermisst. Der Leser wiederum gerät so in den Sog einer Dynamik beredter Stille, in der spürbar die norwegische Landschaft den Erzählfluss mitbestimmt.
Jon Fosse erzählt radikal von innen her, wo eine Vielfalt an Sphären sich beständig kreuzen, sich berühren, um wieder auseinanderzudriften. Wirklichkeit kreiert sich beständig neu, um wieder verworfen zu werden. Die äußere Welt mit ihren politischen und gesellschaftlichen Aporien scheint von diesem radikalen Innenraum des Erzählens mit seinen Wiederholungsstrukturen und gezielt eingesetzten Redundanzen ausgeblendet. Grell im Focus hingegen einzig und allein das Individuum in seiner Vulnerabilität angesichts des Dramas des Menschseins zwischen Geburt und Tod, Schicksal, dem es ohnmächtig ausgeliefert scheint. Der Ich-Erzähler ein alternder Mann, seelisch angeschlagen im Zuge des Verlusts seiner Frau und so konfrontiert mit einer fragilen Existenz, mit der er nicht zurechtkommt. Ein Mensch in seiner Pein, in seiner Not. Ein Mensch in seiner Angst. Nach Heilung fahndend und Heil findend in der Zuflucht zur Religion, in der Zuflucht zum Gebet, woran er zwar zweifelt, was ihm letzten Endes jedoch hilft.
Alles in allem eine komplexe Reflexion über Zeit und Raum, Sein und Identität, Religion, Heil und Heilung. Ein Buch über das Getrenntsein des Menschen von Gott und seine Bestrebungen, über das Medium der Kunst wieder zu einer Einheit mit ihn zu gelangen, ein fortlaufender Erzählfluss ohne Punkt ...
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
*Etwas irritierend, besteht die Heptalogie zwar aus sieben Teilen, die jedoch auf drei Bände verteilt sind, wovon der vorliegende der zweite mit Teil III-V besagter Heptalogie ist.
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt Verlag, Hamburg

Buchtipp Februar 2022
© Hartmut Fanger
Rettet die Hühner
Deb Olin Unferth: „Happy Green Family“
Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 2022, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Barbara Schaden
Die US-amerikanische Autorin, ehemalige Sandinista in Nicaragua und Preisträgerin zahlreicher literarischer Auszeichnungen, Deb Olin Unferth, hat einen Roman vorgelegt, der nicht nur vielen Tierschützern aus dem Herzen sprechen wird, sondern auch den Verbraucher zum Nachdenken anregt, sein Konsumverhalten – spätestens beim Frühstücksei – zu überdenken. Es geht um die riesigen Hühnerfarmen in dem US-amerikanischen Bundesstaat Iowa, wo die Tiere unter unvorstellbar grausamen Umständen eingepfercht sind. Dabei versteht es Deb Olin Unferth, den Leser mit Witz, lockeren Formulierungen und einem gekonnten Spannungsaufbau auf 288 Seiten bei der Stange zu halten und trotz detailgetreuer Schilderungen der verwahrlosten Legehennenbetriebe bis zum Schluss weiterlesen zu lassen.
Doch wie bringen die zwei Legehennenbetriebsprüferiinnen – die fünfzehnjährige Janey und die Freundin ihrer verhassten Mutter, Cleveland –, es fertig, einen 150 Meter langen Stall in der Größe von fast anderthalb Fußballfeldern, „so groß wie die vier größten Dinosaurier, die je auf Erden gewandelt sind“ und worin sage und schreibe von ‚hundertfünfzigtausend Legehennen vierzig Millionen Eier produziert’ werden, heimlich und illegal leerzuräumen. Es gilt ja nicht nur, die Tiere zu befreien, sondern zugleich an anderer Stelle unter hygienischen Bedingungen unterzubringen. Kein leichtes Unterfangen. Und was, wenn eines Tages vor Ort ein Feuer ausbricht …
Spannend dementsprechend die geschilderten Umstände, die frei nach Nietzsche eine „Umwertung aller Werte“ beinhalten: Eine Welt, in der Tierquäler auf der Seite des Rechtes stehen und die Schützer der Schöpfung von vornherein kriminalisiert werden. Da mutieren die Protagonisten – nach dem Vorbild des legendären Rebellen in mittelalterlichen englischen Balladen, der sich bekanntlich für Unterdrückte und sozial Benachteiligte gegen das Gesetz eingesetzt hat – zu einer Art modernem Robin Hood.
Kenntnisreich schildert die Autorin überdies die Hühnergattung, dringt bis in deren Gehirnstruktur vor. Wie denken die Tiere, wie nehmen sie die Welt wahr, was benötigen sie, um in einer für sie zuträglichen Umgebung aufzuwachsen. Zugleich geht sie der Spezies bis zu deren Ursprung nach – ohne dabei auch nur im Ansatz den Anspruch erheben, den Leser belehren zu wollen.
Ein Roman, der, teils nah an der Realität, in seiner Fiktion jedoch stets genügend Freiraum lässt, um Phantasie freizusetzen, zugleich Lesevergnügen trotz der darin zur Sprache kommenden harten Fakten.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Klaus Wagenbach Verlag!
Buchtipp Januar - Februar 2022

© Erna R. Fanger
Alle, die die Schönheit der Erde betrachten, finden einen Quell der Kraft darin,der Bestand haben wird, solange es Leben gibt. Rachel Carson
Glühendes Plädoyer für das schöpferische Vermögen allen Seins
Richard Powers: „Erstaunen“
Aus dem amerikanischen Englisch von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié. Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2021
Mit „Erstaunen“ bringt Powers, vielfach ausgezeichneter und preisgekrönter Autor, eine bemerkenswerte Vater-Sohn-Geschichte auf über 300 Seiten packend nahe, und dies mit zahlreichen Referenzen auf aktuelle Erkenntnisse in Ökologie, Neurowissenschaft, Astrobiologie. Zugleich ein Beitrag zur Diversity-Debatte, denn Robin, neun Jahre alt, leidet unter dem Asperger-Syndrom. Überdies ist er seit dem Unfalltod seiner Mutter – kurze Zeit später stirbt auch noch der geliebte Hund – emotional zusätzlich geschwächt. Hochbegabt, hoch sensibel, erträgt er den normalen Schulalltag kaum, wo eher Mittelmäßigkeit belohnt als außerordentliches Talent gefördert wird. Wer nicht stromlinienförmig tickt, ‚Sonderlingen‘, kommt man mit harter Bandage bei. Hellsichtig erkannte Robins Mutter bereits: „Die Welt wird dieses Kind in Stücke reißen“ Leseprobe. Und es kommt dann auch schon mal vor, dass er gewalttätig wird. Um ihn davor zu schützen, dass man ihn im Zuge zweifelhafter Diagnosen mit Psychopharmaka ruhigstellt, nimmt ihn sein Vater, Astrobiologe, kurzerhand von der Schule und fährt mit ihm in die Berge, wo er sich die unberührte fantastische Natur zunutze macht, für Robin Planeten erfindet, die zu erkunden sie immer wieder aufbrechen:
„Er … benetzte einen Objektträger mit Wasser aus einem Gezeitentümpel. Lebewesen überall: Spiralen und Stäbchen, Objekte wie Fußbälle und feine Fäden, mit Rippen, Poren oder Geißeln besetzt. Er hätte eine Ewigkeit gebraucht, alle Arten zu zeichnen, so viele gab es.“ Leseprobe
Unbequem war Robin nicht zuletzt auch im Hinblick auf seinen unbedingten, ja verzweifelten Willen, sich leidenschaftlich für Umwelt- und Naturschutz zu engagieren, den Planeten zu retten. Und das in der Trump-Ära, wo der Roman angesiedelt ist und dies alles andere als gefragt war. Im Übrigen eiferte er seinen Eltern nach – Mutter Aly etwa hatte sich entschieden für den Tierschutz eingesetzt und konnte mit ihrer Begeisterungsfähigkeit eine Menge Leute für ihre Mission gewinnen.
Aber natürlich war die Zeit des freien Lebens in wilder Naturlandschaft irgendwann vorbei. Die Schulpflicht rief und damit die Frage nach einer adäquaten Therapie für Robin. Sein Vater überlegt, ob „Decoded Neurofeedback“ eine Möglichkeit wäre. Verfahren der KI, bei dem bei Zielpersonen durch Stimuli bestimmte Emotionen erzeugt, die dann wiederum gescannt und auf eine zweite Probandengruppe übertragen werden und das indessen in der Therapie posttraumatischer Belastungsstörungen eingesetzt wurde. Entwickelt hatte es Martin Currier, hoch angesehener Professor der Neurowissenschaften und einst befreundet mit Robins Mutter, die an einem dieser Experimente bereits teilgenommen hatte, von deren emotionalem Abdruck er also noch Aufzeichnungen hatte. Würden diese auf Robin übertragen, bestünde die Chance, dass seine emotionale Verfasstheit entsprechend positiv beeinflusst werden könnte. Versuch, der bedingt auch gelingt, aber weitere Konflikte auf den Plan ruft. Irgendwann kommt es dann zum dramatischen Showdown.
Trotz aller Tragik, das Schicksal der hier ins Bild gerückten kleinen Familie betreffend, ist dies ein zutiefst lebensbejahendes Buch voller überraschender Erkenntnisse über die unermessliche Schöpferkraft des Lebens schlechthin.
„… wenn sie [Dozentin Ethel Muggs] … vor vierhundert Studenten im Hörsaal stand, dann glühte sie. Woche um Woche führte sie uns allen aufs Neue vor, wie wenig wir wussten, ja, dass wir keine Ahnung von all den Dingen hatten, zu denen das Leben imstande war.
"Es gab Geschöpfe, die sich um die Mitte ihres Lebens in etwas so vollkommen anderes verwandelten, dass man sie gar nicht mehr als dieselbe Art wiedererkannte. Es gab Geschöpfe, die sahen Infrarotlicht und spürten Magnetfelder. Es gab Geschöpfe, die veränderten ihr Geschlecht in Absprache mit der Umgebung, und Einzeller, die sich nach Mehrheitsbeschluss organisierten.“ Leseprobe
Und während wir uns noch fragen, wann der so dringlich erhoffte Wandel hin zu einer humaneren Gesellschaft endlich eintritt, einer Gesellschaft, der es gelingt, das Ruder herumzureißen und diese Erde zu einem guten Ort für alle zu machen – dieses Buch zeugt davon: Machtvoll ist er längst in Gange!
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Verlag S. Fischer,
Frankfurt am Main
Buchtipp des Monats Januar 2022

© Hartmut Fanger: Eine Familie Anfang der Siebziger in Amerika
Jonathan Franzen: „Crossroads“
Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2021
Wer von denen, die sie selbst erlebt haben, erinnert sich nicht an die siebziger Jahre, an die Musik, die Mode, jenen Aufbruch, der 1968 mit der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung seinen Lauf nahm, gefolgt von den bald weltweiten Anti-Vietnam-Demonstrationen. Die Jüngeren wiederum werden auf über 800 Seiten in Jonathan Franzens „Crossroads“ umfangreich und detailgenau davon erfahren. Auftakt einer großen Roman-Trilogie. Dabei nimmt der Autor ausgerechnet eine mittelständische Pastorenfamilie wie die Hildebrandts in Chicago zum Ausgangs- und Mittelpunkt seines Epos‘, womit jede Menge Reflexion, religiöse, ethische wie moralische Fragestellungen zum Tragen kommen. Und Franzen lässt wahrlich nichts aus, dringt in die innerste Psyche seiner Protagonisten, erzählt dabei eloquent deren Geschichte. Da changieren persönliche Krisen und Nöte von Kindern in der Pubertät mit denen der Erwachsenen in der Midlife-Crisis. Zugleich kommen spießige und von Schuld beladene außereheliche Liebesbeziehungen zur Sprache, wo sich Abgründe auftun, wie etwa die verschämten regelmäßigen Besuche von Mutter Marion in einer als Zahnarztpraxis getarnten psychotherapeutischen Einrichtung. Junge Männer wiederum unterm Banner von Vietnamkrieg und dem Damoklesschwert des per Losverfahren drohenden Militärdiensts. Und natürlich spielt dem Zeitgeist entsprechend die Drogenproblematik eine Rolle. Es geht ums Dealen, Kiffen und darum, wie man es schafft, high zu sein. Beeindruckend und minutiös beschrieben die erste Marihuana-Erfahrung von Tochter Becky, einem spirituellen Erlebnis – ‚Gebet an Gott auf einem Dachboden der Kirche im Dunkel der Nacht’ sowie die Erkenntnis, dass ‚Zeit nicht ohne Licht gemessen werden kann’.
Außergewöhnliche Ereignisse, etwa auch Wetterlagen, erfordern in der Regel außergewöhnliche Maßnahmen und sind gerade deshalb im Kreativen Schreiben ein beliebtes Stilmittel, bergen sie doch immenses Spannungspotenzial. Franzen nutzt dies verstärkt, indem er es in dem ersten, mit „Advent“ überschriebenen Teil auf vielen Seiten nahezu unentwegt schneien lässt. Da kommen so manche der Protagonisten sprichwörtlich wie im übertragenen Sinne ins Rutschen, bleiben Autos stecken, gerät so mancher Zeitplan durcheinander, ist von Räumungsarbeiten die Rede.
Der Verdacht liegt nahe, dass wir es mit einem Roman zu tun haben, wie man ihn heute eigentlich nicht mehr schreiben kann. Alles ist ausformuliert, so dass für den Leser kaum mehr Spielraum für eigene Deutungen bleibt. Und dennoch entsteht von Beginn an ein Lesefluss, ja Sog, dem man sich, stilistisch ausgefeilt, bis zum Schluss hin kaum entziehen kann. Der Leser möchte jedenfalls unbedingt wissen, wie es weitergeht. Franzen ist einfach einer der ganz großen Erzähler der Gegenwartsliteratur!
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Buchtipp Dezember 2021-Januar 2022
© Erna R. Fanger: Aus der Sicht eines Liebenden
– Poetische Montage
„Das Abenteuer der Liebe ist Sehnsucht, nicht Erfüllung.
Das wollen die Menschen nicht glauben,
weil sie Verbraucher sind“. Edgar Selge

Edgar Selge: „HAST DU UNS ENDLICH GEFUNDEN“, Rowohlt Verlag, Hamburg 2021
Edgar Selge, bislang als begnadeter Schauspieler in Erscheinung getreten, hat uns mit diesem Debut als Schriftsteller überrascht. Werden Metamorphosen dieser Art von der Hoheit der Literaturkritik eher skeptisch in Augenschein genommen, hat Selge jedoch, entgegen manchem Unkenruf im Vorfeld, die Erwartungen durchaus übertroffen. Dass er hier nicht autobiografisch geschrieben, als vielmehr montiert und verdichtet hat, darauf besteht er.*
Den Rahmen dieser Art Collage szenischer Darstellungen – weniger chronologisch als vielmehr Kaleidoskop gleich in 19 Kapiteln plus Epilog arrangiert – bildet das Herforder Jugendgefängnis, dessen Direktor Selges Vater ist. Aufgabe, der er mit Herzblut frönt. Umständehalber nach dem Zweiten Weltkrieg an seiner eigentlichen Mission, Pianist zu werden, gehindert, gehört dazu, die musikalische Erziehung seiner Zöglinge voranzutreiben, im Zuge dessen er nachmittags regelmäßig Hauskonzerte für diese veranstaltet, abends dann für Freunde und Bekannte, wofür er eigens einen professionellen Geiger engagiert.
Aus der Sicht des Zwölfjährigen und mit der Pubertierenden eigenen Luzidität, nicht zuletzt aber auch mit Hilfe des Wissensvorsprungs seiner älteren Brüder, durchdringt er den Wust des verhängnisvollen Erbes des Nationalsozialismus mit seinen fatalen ideologischen Vorzeichen, in dem seine Eltern noch tief verwurzelt scheinen, und der zwiespältigen Jahre des deutschen Wirtschaftswunders, unter deren Decke es zwar brodelt und schwelt, worüber aber ein eiserner Mantel des Schweigens gebreitet scheint. Unter der Decke wiederum der im Hause Selge priorisierter kultureller Aktivitäten – in erster Linie Musik, aber auch Literatur und Malerei –, womit kompensiert wird, was nicht zur Sprache kommen darf, ist das Klima explosiv. Immer wieder entlädt es sich in ätzenden Auseinandersetzungen zwischen dem Vater und Edgars älteren Brüdern, die diesen schonungslos zur Rede stellen. Erst spät und in einem schmerzhaften Prozess erkennen die Eltern, welcher Geistesverwirrung sie aufgesessen sind.
Was das Buch auszeichnet, ist seine allgegenwärtige Ambivalenz. Nichts scheint eindeutig als vielmehr brüchig, rissig. Nach Manier des Kubismus nimmt Selge Figuren und Ereignisse von allen Seiten gleichzeitig in Augenschein, alles scheint fluid, in beständigem Fließen, Bröseln, im Rutschen begriffen. Dabei enthält sich Selge jeder Wertung. Stattdessen durchdringt er die Dinge in fiktionaler Verdichtung und spürt so die Wahrheit hinter den Phänomenen auf.
So auch den dramatischen Tod seines Bruders Andreas, dem ursprünglich nachspüren zu wollen, Ausgangspunkt war, dieses Buch zu schreiben, was schließlich in den bemerkenswerten Epilog eingeht. Dort hadert Selge mit sich selbst, dem Sterbenden die Bitte verweigert zu haben, ihm einen Schluck Tee wider strikte ärztliche Anordnung zu gewähren. Wider sein Mitgefühl mit dem Dürstenden. Ob er es bereue, fragt Bruder Andreas in einem fiktiven Zwiegespräch. Natürlich. Aber er sei so ein Mensch. Er könne sich hart machen, sich seinen Gefühlen verschließen. Ob er ein anderer sein wolle, fragt er sich selbst. Nein.
Und obwohl er seitens des Vaters körperliche Züchtigung wie, unvermittelt angedeutet, gar sexuellen Missbrauch erfährt, bekennt er, innerlich zwiespältig und nicht ohne Scham, ihn zu lieben. Zugleich aber auch: „Ich will nicht einer sein, der den liebt, der ihn schlägt“ Leseprobe. Dies schließt an die Präambel an, ‚Das Abenteuer der Liebe ist Sehnsucht, nicht Erfüllung‘, und verweist, wie das gesamte Werk, einerseits auf die Unzulänglichkeit von Menschen, Liebe zu leben, und zielt zugleich auf unser aller Sehnsucht danach ab, wie sie gerade in der Weihnachtszeit zum Tragen kommt.
Wir empfehlen „Hast du uns endlich gefunden“ daher unbedingt als Lektüre zwischen den Jahren und darüber hinaus. Auf jeden Fall ein beachtlicher Einstand Selges als Autor – Chapeau!
*16.10.2021, Der Tagesspiegel: Gerrit Bartels: „Liebe und Missbrauch“
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt Verlag
Buchtipp Oktober 2021

© Hartmut Fanger
Von der Magie der Berge
Paolo Cognetti:
Das Glück des Wolfes, Roman, Penguin Verlag, München 2021 Aus dem Italienischen von Christiane Burkhardt
Wie schon in seinem ersten erfolgreichen Roman Acht Berge sowie dem Folgeband Gehen, ohne je den Gipfel zu besteigen, spielt auch in „Das Glück des Wolfes“ die Handlung in den Bergen, werden hier zugleich buddhistischer Glaube und buddhistische Lebensweisheit nahegebracht.
Dabei vermag kaum einer, die Gebirgswelt so lebensnah und authentisch zu schildern wie Cognetti. Begeisternde Landschaftsbeschreibungen. Von Beginn an versetzt der Autor den Leser so in eine nahezu magische Sphäre der schneebedeckten Gipfel, der unberechenbaren Naturereignisse und der Sehnsucht der Menschen vor Ort nach Freiheit. Letztere tritt insbesondere dann zutage, wenn zum Beispiel am Horizont das eine oder andere Flugzeug Richtung Paris gesichtet wird. In dem kleinen italienischen Dorf Fontana Fredda, wo der größte Teil der Handlung spielt, genauer in dem ebenso kleinen Restaurant mit dem klangvollen Namen „Babettes Gastmahl“, findet das mühsame Leben in 1800 Metern Höhe statt. In der Wintersaison treffen sich dort die Skifahrer und Bergwanderer oder Arbeiter, die die Pisten wiederherstellen, diese mit Kunstschnee versorgen. Ein Ort, der jährlich um seine Existenz bangen muss, in dem die Klimaveränderung deutlich zu spüren ist, ein Ort ohne Zukunft, und dennoch ein Ort, der den Figuren so etwas wie Heimat vermittelt, ihnen, wenn auch nur saisonbedingt, Arbeit gibt. Menschliche Schicksale, Liebe und Tod, alles drängt sich hier auf engem Raum. Die Welt betrachtet, wie durch ein Mikroskop. Umso bemerkenswerter, dass aufgrund des ‚Klimas und von Flora und Fauna ein Aufstieg von tausend Höhenmetern in den Alpen einer tausend Kilometer weiten Reise nach Norden entspricht.’ Da wird die Welt plötzlich wieder ganz groß ... Als Pendant hierzu fungiert die Großstadt Mailand, in die es den Protagonisten allenfalls dann verschlägt, wenn formelle Angelegenheiten, wie Scheidung oder die Inanspruchnahme eines Kredites, zu regeln sind.
Protagonist wiederum ist der in „Babettes Gastmahl“ als Koch eingestellte Schriftsteller Fausto. Zwischen ihm und der neuen Kellnerin Silvia wiederum entspinnt sich eine zarte Liebesgeschichte. Im Übrigen gelten seine Interessen, neben dem Leben in den Bergen, vornehmlich der Literatur. Von Jack London bis hin zu Hemingways „In einem anderen Land“, von Tania Blixens „Jenseits von Afrika“ bis hin zu Bruce Chatwins „Traumpfade“ in Australien. Nicht zu übersehen gleichwohl die Korrespondenz des Restaurantnamens mit dem Titel der berühmten, auch verfilmten Novelle von Tanja Blixen, „Babetts Fest“.
Das Titel gebende ‚Glück des Wolfes’ mag darin bestehen, dass in dem Maß, wie der Mensch seine Lebensgrundlagen zerstört, dieser sich den ihm zustehenden Lebensraum zurück erobert.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl! Archiv
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Penguin Verlag!
Buchtipp September - Oktober 2021

© Hartmut Fanger: Generationenroman – So kurzweilig wie brillant
Jo Lendle: „Eine Art Familie“, Penguin Verlag, München 2021
Mit „Eine Art Familie“ veröffentlicht der 1968 geborene Jo Lendle seinen fünften Roman. Erzählt wird diesmal die Geschichte seiner eigenen Familie. Dementsprechend sind seine Figuren ‚echt’ und tragen folglich real existierende Namen. So hat es den Protagonisten und Naturwissenschaftler Ludwig Lendle von 1899 bis 1969 tatsächlich gegeben. Eine Zeitspanne, die auch dem Roman zugrunde liegt: vom Kaiserreich bis hin zum Nationalsozialismus, von den ersten Tagen der DDR bis hin zur Bundesrepublik. Deutsche Historie pur. Wie dicht beieinander die Abfolge geschichtlicher Ereignisse im Zeitkontinuum liegt, erweist sich anhand lediglich einer ‚kleinen Reihe von Menschenleben’, derer es bedürfe, um ‚beim Christuskind an der Krippe zu stehen’: Ludwigs eigener ‚Großvater hätte als Kind Goethe die Hand geben können. Und Goethe selbst war schon geboren, als Bach noch lebte ...’ und sofort.
Während Ludwig Lendles Bruder Wilhelm in den Nationalsozialismus abgleitet, hat Ludwig Lendle gegen das System auf vielen Ebenen zu kämpfen, was sich bis in die Arbeitswelt der medizinischen Fakultät bemerkbar macht. So wird er zum Beispiel in einem offiziellen Schreiben des Ministeriums beschuldigt, sich über die Anschaffung einer Hakenkreuzfahne abfällig geäußert zu haben. Dagegen ist seine wissenschaftliche Schlaf-Forschung gerade auch für den politischen Machtinhaber von nicht unerheblichem Belang. Schließlich mündet diese direkt in das im Krieg verwendete Nervengas. Dabei versteht es der Autor, die verheerende Politik mit kleinen Alltagsszenen zu illustrieren, mit den kleinen Freuden, großen Ängsten und Sorgen der Menschen. Denn ‚es geht’ ihm im Hinblick auf die in der Präambel skizzierte Forderung Stendhals um ‚mehr Details’, worin ‚Eigenart und Wahrheit’ zu finden seien. Letztendlich gehe es ‚ums Ganze, das sich wie immer in seinen Teilen zeige’. Von „‚den schwer lesbaren Botschaften der Wolken“ bis hin zu den „zusammengezogenen Augenbrauen einer Radfahrerin“. Und vor allem geht es dem Titel des Romans entsprechend um eine notgedrungene familienähnliche Situation. So lebt Ludwig Lendle mit seiner Nichte Alma Grau und Fräulein Gerner zusammen. Eine Figurenkonstellation, die Lud Lendle wie folgt selbst auf den Punkt bringt: „Drei eigenartige Menschen, ein seltsam versprengter Haufen, von Zufällen zusammengewürfelt, ohne rechte Verbindung und ohne Zukunft, von denen man nur eines lernen kann: Wie man ausstirbt.“ LESEPROBE Denn von Kindern kann schon aufgrund der verkappten Homosexualität Ludwig Lendles nicht die Rede sein. Wie Sexualität überhaupt im Wesentlichen unterdrückt wird. Stattdessen erfreut man sich an der Suche nach Steinpilzen, an Rahbarbarkuchen oder im Nachkriegsjahr 1946 an einer Eierlikörtorte, die während eines Gesprächs über „Das Wesen der Lust nach den platonischen Dialogen“ auf der Terrasse des Philosophen Gadamer zu sich genommen wird.
Meisterhaft die Anwendung des Stilmittels der Auslassung. Kein Wort zu viel, der Verzicht auf überflüssige Adjektive, Füllwörter und unnötige Wiederholungen. Oft ist es zudem der sachlich kalte, nüchterne Bick des Wissenschaftlers und Mediziners, der ähnlich wie schon im „Zauberberg“ des Thomas Mann in den Bann zieht. Doch anstatt der Schilderungen an Tuberkulose Erkrankter sind es hier die Szenen, in denen Tierversuche praktiziert werden, mit Fröschen und Mäusen experimentiert wird. Dabei bleibt dem Leser überlassen, die ganze Tragweite solcher Untersuchungen nachzuempfinden, was wiederum Phantasie freisetzt. Hinzu kommen die so poetischen wie originellen Kapitelüberschriften, wie zum Beispiel „Herz und Abendstern“, „Kautschuk und Nähe“ oder „Schwäne und Himbeeren“. Alles in allem ein ungemein lesenswertes Buch, das uns epochale Wirklichkeiten in Politik, Wissenschaft wie im Alltagsleben nahebringt. Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl. Archiv
Mit Dank für das Rezensionsexemplar an den Penguin Verlag!
Buchtipp August - September 2021

© Hartmut Fanger Atlantropa oder Die Sehnsucht nach Frieden in der Welt
Matthias Lohre: „Der kühnste Plan seit Menschengedenken“, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2021
Ein Glück, dass aus den unverlangt eingesandten Manuskripten gerade das Debut des Journalisten Matthias Lohre der Lektorin Annette Wassermann in die Hände fiel.Nun dürfen auch wir in 41 Kapiteln und auf 480 Seiten den ‚kühnsten Plan seit Menschengedenken ’mitverfolgen.
Der Roman spielt vornehmlich in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. Erzählt wird die wahre Geschichte des Architekten Herman Sörgel und dessen Frau Irene. Herman Sörgel entwickelt einen kühnen Plan. Er will das Mittelmeer mit Hilfe gewaltiger Staudämme anheben und trockenlegen, um dort stattdessen für fruchtbares Land und ein friedvolles Miteinander zu sorgen. Atlantropa bezeichnet er schließlich seinen Traum, da Europa im Zuge dessen mit den Küstenregionen Afrikas zusammenwüchse. An Authentizität gewinnt das Ganze, indem den jeweiligen Kapiteln u.a. historische Dokumente in Form von Zeitungsberichten, Zitaten aus Briefen und Romanen vorangestellt werden.
Dabei findet die Handlung insbesondere vor der Kulisse eines krisengeschüttelten Deutschlands im Umkreis der schwächelnden Weimarer Republik mit zunehmender Kriegsgefahr, Massenarbeitslosigkeit, Judenverfolgung und erstarkten Braunhemden statt. Bereits zu Beginn sind dementsprechend erste Einflüsse der Nationalsozialisten vernehmbar. Ein Klima, das die Protagonisten immer mehr zu spüren bekommen, zumal Irene Sörgel Halbjüdin ist. Doch die Träume der Protagonisten sind groß. Mit Vorträgen und Ausstellungen setzen sie alles daran, die Mächtigen im Lande von ihrem Plan zu überzeugen. In dem Moment, als sich schließlich auch die Nationalsozialisten für das Projekt begeistern, kommt es für den Protagonisten allerdings zum Konflikt. Hermann Sörgel sieht sich gezwungen, sich zwischen der Realisierung seines Traums und der Liebe zu Irene entscheiden. Meisterhaft versteht es Lohre, fiktive Erzählsequenzen mit stichhaltigen historischen Fakten zu einem großen Ganzen zu verweben.
Packend liest sich der abenteuerlich anmutende Weg Sörgels – allen Widerständen zum Trotz –, dem Umfeld eine derartige Utopie nahebringen zu wollen, dafür zu werben, Kontakte zu knüpfen, Politik und Presse für sich zu gewinnen, sich selbst vor dem Ertrinken im Mittelmeer zu bewahren. Und es sind vor allem die kleinen, so plastischen wie spannenden Szenen, die den Leser bis zum Schluss bei der Stange halten. Beeindruckend zum Beispiel der Moment, wo das Mittelmeermodell für die Ausstellung ein Leck aufweist und Sörgel zusammen mit dem Reichsarbeitsminister Adam Steigerwald versucht zu retten, was zu retten ist.
Mit besagtem historisch verbürgtem Hintergrund ein Roman, der angesichts der weltweiten Klimakrise mit entsprechender Fluchtbewegung zusätzlich an Aktualität und Brisanz gewinnt. Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl! Archiv
Mit Dank für das Rezensionsexemplar an den Verlag Klaus Wagenbach.
Buchtipp Juli - August 2021
Buchtipp des Monats Juli - August 2021
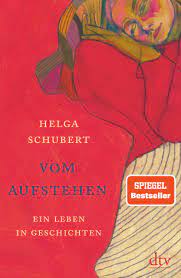
© Erna R. Fanger: Heimisch in Erinnerungen
Helga Schubert: Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten, dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München 2021
„So konnte ich alle Kälte überleben. Jeden Tag. Bis heute“ Leseprobe, lautet der letzte Satz des ersten Kapitels in dem 300 Seiten zählenden Buch von Helga Schuberts Leben in 29 Geschichten. Der Satz beschreibt präzise, was wir heute als Resilienz bezeichnen, also psychische Widerstandskraft gegen die niederschmetternden Härten des Lebens. Was es dazu bedarf, wird in besagtem Kapitel selbst deutlich. Es ist die Erinnerung an die wunderbaren langen Sommerferien bei der Großmutter, in der Hängematte zwischen zwei Apfelbäumen, den Duft nach warmem Streuselkuchen in der Nase. Diese Großmutter ist es auch, von der sie sich geliebt fühlt, im Gegensatz zur ablehnenden Mutter, die für das kleine Mädchen wenig übrighat. Der Vater ist im Krieg gefallen. Der erste Satz wiederum ist Programm: „Mein idealer Ort ist die Erinnerung“Leseprobe. Und entscheidende Erinnerungen finden sich auch gegen Schluss des Buches wieder, wo sich die Autorin, vier Jahre nach dem Tod der Mutter, erinnert, wofür sie ihr, über den Dank am Sterbebett hinaus, dass sie ihr das Leben geschenkt habe, des Weiteren dankbar sei. Und da kommt überraschend viel zusammen – etwa nach dem Motto Erich Kästners „Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit“. Dies bildet die Klammer der hier erzählten Geschichten aus dem Leben Helga Schuberts in der ehemaligen DDR, die gleichsam ein Stück Zeitgeschichte transportieren. Und doch dreht sich letzten Endes alles immer wieder um das schwierige Verhältnis zur Mutter, die immerhin 101 Jahre alt geworden ist, ihrer Tochter somit eine lange Zeitspanne gewährt hat, sich daran abzuarbeiten. Dem kommt Helga Schubert, um Identität ringend, nahe, indem sie zum Beispiel Strategien entwickelt, ‚die Schatten hinter sich zu lassen‘. So notiert sie sich Sätze aus Lektüren, Zeilen von Gedichten oder Liedanfänge, die sie durch Zeiten der Mutlosigkeit und der Trauer tragen. Und „Warum schreiben“ – Kapitel, in dem sie, ausgehend von ihrer Liebe zum Altweibersommer, wo sie ‚endlich ausatmen kann, wie beim Schreiben‘, spielend leicht Zugang zu dem Thema findet und fragt, was Menschen veranlasse, eine Zeit lang alles hinter sich zu lassen, Freunde, Familie, Kollegen, um sich völlig von der Welt zurückzuziehen, in dem Vertrauen, dass sich im Zuge dessen eine Geschichte in ihm verdichte. „Woher kommt der Mut, diese schmale, wankende Brücke zu den Menschen, die am andern Ufer lärmen, zu bauen, diese Brücke ohne Geländer zu betreten und hoch über dem Abgrund zu balancieren, ganz allein?“ Leseprobe Wer schreibt, muss genau hinsehen, dem Erschrecken standhalten angesichts der Abgründe, an denen entlang sich menschliche Existenz hangelt, seien es die eigenen, seien es die der anderen. „Nichts ist klar so oder so, erfahre ich beim Schreiben oder spätestens beim Lesen.“ Leseprobe
Wie Erinnerung sich vollzieht, in Fetzen und Fragmenten, offenbart sich auf kaum mehr als zwei Seiten im zweiten Kapitel, „Vom Leben innen“, wo neben Orte der Erinnerung, etwa an das Pathos der Mutter beim Singen an der Seite von Blauhemden der FDJ beim Weltjugendtreffen, Belange von Alltagsbewältigung platziert werden, wie ‚daran zu denken, beim Autofahren Gas zu geben, einen Wagen zu lenken‘. Dass davon, nicht wie in der Vorstellung, ganz unmittelbar ‚etwas abhänge‘. Zugleich reichen wenige Pinselstriche aus, die Einsamkeit der Fünfzehnjährigen nahezubringen, die, der Mutter von ihrem „Gefühl der Unwirklichkeit“ erzählend, von dieser der Schizophrenie verdächtigt wird. Über den Selbstmord eines Mitschülers tröstet sie sich mit Klavierspielen hinweg. Ein Jahr lang hatte die Mutter ihr den Unterricht bei einer Pianistin bezahlt, dies, nachdem diese ihr Talent bescheinigte, jedoch wieder eingestellt.
Immer wieder zieht sich die Erinnerungsspur an die erfahrenen Verletzungen seitens der Mutter durch ihre Geschichten. Und war dies für die bemerkenswerte Professorin, Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin Barbara Vinken in Scobels Büchertalk ein entschiedenes No Go, sei dem entgegengehalten, dass es keine Seltenheit ist, dass mit fortschreitendem Alter oft lange unten gehaltene Erinnerungen an empfundenes Unrecht noch einmal an die Oberfläche gespült werden und bearbeitet werden wollen. Bestenfalls, um am Ende seinen Frieden damit zu machen. Und Letzteres ist Helga Schubert mit diesem Kleinod – einem ganzen Leben in lauter kurzen Geschichten – mit Bravour gelungen.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl! Archiv
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem dtv Verlag, München 2021
Buchtipp Juni - Juli 2021

© Erna R. Fanger
Jahrzehnt im Grenzgang
Gabriele von Arnim: Das Leben ist ein vorübergehender Zustand, Rowohlt Verlag, Hamburg 2021
„Zehn Jahre lang sitzt die Angst mit am Tisch – oder ihre kleinen Cousinen Unruhe, Sorge, Bangigkeit sitzen neben mir auf dem Sofa, am Schreibtisch, sitzen mit mir am Herd, liegen mit mir im Bett.“ Leseprobe Was bewegt Leser:innen, sich auf die Spuren der intimsten Abgründe eines Schicksals zu begeben, vor dem man innerlich erschaudernd zurückweicht, was Autor:innen, ein solches mit anderen zu teilen, indem sie es öffentlich machen und erzählen. Frage, die an die Grundfeste der Funktion von Literatur rührt. Und gemeinsam scheint Lesenden wie Schreibenden zu sein, dass sie die Absicht hegen, existenzielle Belange zu erhellen, ihnen auf den Grund zu gehen, genau hinzuschauen und für sich selbst mit jedem Buch die Frage neu zu beantworten und zu vertiefen, wie geht das überhaupt, Leben? Im Falle Gabriele von Arnims jüngstem Buch „Das Leben ist ein vorübergehender Zustand“, wie geht Leben an der Grenze dessen, was ein Mensch zu (er)tragen vermag. So, wenn der langjährige Ehemann im Zuge von Herzinfarkt und Schlaganfall in Folge innerhalb kürzester Zeit vom brillant-eloquenten Intellektuellen und Medienmann zum bettlägerigen Pflegefall mutiert. Geistig hellwach, körperlich versehrt, unfähig, sich zu artikulieren, ohne Aussicht auf Besserung, ist er von nun an vollkommen angewiesen auf die Hilfe anderer.
Was es für die Autorin bedeutet hat, sich ein Jahrzehnt lang auf dessen Pflege einzulassen, lässt sie uns, nach dessen Tod dem Appell einer Freundin, „erzähl es“, folgend, mit diesem Buch – Art Lebens- und Sterbensbilanz – wissen. Was diesen Prozess auszeichnet, ist die Genauigkeit, ihre Ehrlichkeit, mit der sie sich an den Grund des Unsagbaren herantastet. Diesem Zustand zwischen Schmerz und Entsagung, zwischen Hoffen, Bangen, Resignation und Verzweiflung. Immer wieder aber auch sind es Glücksmomente, Humor und ihr unabdingbarer Sinn für Ästhetik, die sich als tragkräftig erweisen, tiefgreifender vielleicht, als in augenscheinlich weniger dramatischer Daseinskonstellation. Etwa ‚die betörende Sinnlichkeit eines üppigen Tulpenstraußes mit orangenen, roten oder weißen Blüten. Die Kelche geöffnet …‘ Und nicht zuletzt zeugt dieses Buch von der Kraft der vielen Lektüren, die hier einfließen und sich als Schutzwall erweisen. Als Schutzwall gegen das Bodenlose, dem wir in solcher Lage ausgeliefert scheinen. Da gibt es ‚Vordenker‘ wie der Mexikaner Oktavio Paz, den sie zitiert, der Tod sei für Pariser, New Yorker oder Londoner „ein Wort, das man vermeidet, weil es die Lippen verbrennt“, in Mexiko hingegen heißt es: „Wenn du mich töten willst, dann mit Küssen.“ Und es gibt Weggefährtinnen, wie die gleichfalls vom Verlust ihrer Lieben gezeichnete und darüber schreibende Joan Didion mit ihrem Credo „Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben“.
Zu diesen zählt nicht zuletzt die englische Journalistin Elisabeth Tova Bailey, die ein gefährlicher, nicht identifizierbarer Virus über Jahre ans Bett fesselt, wobei ihr eine Schnecke, Mitbringsel einer Freundin auf einer Topfpflanze, zur treuen Begleiterin wird, Trost und Verbundenheit gewährt. Als Schutzwall gegen das Unvermeidliche fungiert gleichwohl der gesamte kulturelle Echoraum, den Kunst jeden Genres uns offeriert, in dem Leiderfahrung in vielfacher Spiegelung seit Jahrtausenden gespeichert und ‚aufgehoben´ scheint. Dies impliziert eine Verbundenheit in der Bewältigung menschlicher Existenz mit Generationen vor uns, aus der wir Trost ziehen und Kraft schöpfen.
Die Schwierigkeit, sich über diese innere Bilanz von Arnims in einer Rezension zu äußern, besteht darin, dass alles, was es darüber zu sagen gibt, wiederum das ausschließt, was man darüber nicht sagt, dem jedoch ebenso viel Bedeutung gebührte. Denn das Leben im Grenzgang übersteigt geläufige Wahrnehmungs- und Deutungsmuster. Als Leser:innen wiederum werden wir Zeuge davon, wie es augenscheinlich eines solch ungeheuren Einschnitts bedurfte, dass die Ich-Erzählerin, unmittelbar vor diesem Zusammenbruch in Begriff, sich von ihrem Mann zu trennen, am Ende über besagtes Jahrzehnt schreibt, „Denn in all diesen elenden Jahren, in denen wir gekämpft, gelitten und gewütet haben, haben wir uns und einander auch mit neuer Innigkeit kennengelernt.“ Leseprobe Eine Freundin beteuert, sie möge ihn seither viel mehr, fühlte sich von ihm ‚ganz anders wahrgenommen‘. Über seine Todesstunde erfahren wir „Zwischen uns Stille, eine sanfte Stille und darin eine überraschende Harmonie, ein Einklang zwischen ihm und mir“Leseprobe, und vom Tod, der ihn dann ereilt hat: „Gekommen in dem Moment zarten Einklangs“ Leseprobe. Solch tröstlich anmutenden Abschied vernehmend, sind wir verlockt zu glauben, das alles habe letztlich seinen tieferen Sinn erfüllt und ein gutes Ende genommen – und hätten damit doch die ganze ungeheure Tragweite des Geschehens verfehlt.
Handelt dies Buch im Kern von Schmerz und Leid, Tod und Vergänglichkeit, überstrahlt schließlich die Lebendigkeit des Erzählens alles, die fluide, sinnliche Bildersprache, angereichert mit Referenzen auf Lektüren, Gedanken, Alltagsbeobachtungen, dem Nachsinnen über Schönheit und Sehnsüchte, Heiterkeit, Melancholie und Zärtlichkeit – am Ende ein Buch über die schiere Fülle des Lebens schlechthin.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt Verlag, Hamburg! Archiv
© Hartmut Fanger www.schreibfertig.com
„Forever Young“ – zum Achtzigsten von Bob Dylan
Maik Brüggemeyert (Hrsg.): „Look Out Kid. Bob Dylans Lieder, unsere Geschichten“, Ullstein Buchverlag GmbH, Berlin 2021

Buchtipp des Monats Mai-Juni 2021
© Hartmut Fanger Absurde
Verwicklungen
Jochen Schmidt: Ich weiß noch, wie King Kong starb,Verlag C.H.Beck oHG, München 2021
Auf unvergleichliche Art führt uns Jochen Schmidt mit seinem Erzählband „Ich weiß noch, wie King Kong starb“ die Absurditäten im Leben eines Autors, Vaters und Sohns einer alles dominierenden Mutter vor Augen. Stets mit leichter Feder überspitzt, stets mit Sinn für Humor und Skurriles, Freude an ungewöhnlichen Formulierungen, womit er immer wieder für Überraschungen sorgt. Teils lose miteinander verwobene Erzählungen, die am Ende nahezu als Roman durchgehen. Mit auf den ersten Blick einfachen, harmlosen Begebenheiten, die sich, sehen wir näher hin, jedoch eher als alles andere entpuppen, zieht der Ich-Erzähler seine Leser in den Bann. So zum Beispiel, wenn er während einer Familienzusammenkunft bei den Eltern auf die Toilette flieht, jenem einzigen Raum, in dem keine Bücher stehen, stattdessen „drei Dutzend Putzmittelsorten.“ Nur dort vermag er ‚ein bisschen zu sich zu finden’. Oder die Angst vor dem 10-Meter-Turm des indessen bald Mittvierzigers, selbstgestecktes, bislang verpasstes Ziel, das er mit Hilfe teils absurder Gedankengänge immer wieder hinauszuzögern versteht: „Dann bin ich tatsächlich oben, obwohl ich lieber noch weiter Leitern hochgestiegen wäre, denn jetzt rückt der Moment immer näher.“
Bemerkenswert die so ernüchternden wie wenig rühmlichen Erlebnisse eines Autors, der für sein Buch auf Tour geht, gehen muss. In Kauf zu nehmen sind neben langen Anfahrtswegen in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf denen er seine zum Verkauf angebotenen Bücher selbst transportieren muss, das Nächtigen in heruntergekommenen Pensionen, eine besserwisserische Hörerschaft in einem ehemaligen, zum Kulturzentrum umfunktionierten Schlachthof. Von der verzweifelten Aktion, mit seinen Büchern in einer Buchhandlung präsentiert zu werden, um eine ‚Lücke’ zu füllen, ganz zu schweigen. Insbesondere k-misch und nicht minder kritisch wird es, wenn die Deutsche Bundesbahn mit ihren Zügen als „Stehplatzhotel“ aufs Korn genommen wird. Etliche Schwarzweißbilder wiederum illustrieren die Reise nach Budapest mit David Wagner. Selbst dort ist der Allerweltname Jochen Schmidt offenbar nicht selten, so dass ihm im Zuge einer Verwechslung ein Buch über Pina Bausch, das er nicht verfasst hat, zum Signieren vorgelegt wird.
Köstlich nicht zuletzt Plaudereien aus dem Nähkästchen, etwa über den weltabgewandten Proust, wie aus der Feder von dessen Haushälterin Céleste Albaret zu vernehmen, der ‚nachts arbeiten und tagsüber schlafen musste’, panische Angst vor Staub und Mikroben hatte, oder wenn der Ich-Erzähler in der Hauptfigur aus Gontscharows „Oblomow“ weniger den sprichwörtlich faulen Nichtstuer als vielmehr den ‚sympathischen Hypersensiblen’ sieht. Alles in allem ein Feuerwerk an Ideen, an heiteren Episoden und zum Nachdenken anregenden Momentaufnahmen. So leichte wie tiefgründige Lektüre, gerade richtig für die anstehenden Sommertage.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Verlag C.H. Beck!
Buchtipp des Monats April - Mai 2021
© Erna R. Fanger
Corona-Lockdown – „Pantherzeit“ – Vorboten einer neuen Zukunft
Am 28. Dezember 2020 startete auf NDR Kultur die neunteilige Lesung aus dem noch unveröffentlichten Manuskript von Maria Bodrožić , das diesen Februar unter dem Titel Pantherzeit. Vom Innenmaß der Dinge im Otto Müller Verlag, Salzburg, erschienen ist.
Einer muss den langen Atem haben
Warum Pantherzeit. Es war für die heute in Berlin lebende, aus Kroatien stammende Autorin eine Eingebung, die sie traf wie ein Blitz, sie Rilke aus dem Regal ziehen ließ, um sich das berühmte Gedicht noch einmal zu Gemüte zu führen:

Der Panther
Im Jardin des Plantes, Paris
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf –. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille –
und hört im Herzen auf zu sein.
Rainer Maria Rilke, 6.11.1902, Paris
Die Relektüre des Gedichts im Kontext der Pandemie beschreibt Bodrožićals ‚starken Moment’, der die folgende Zeit ‚vorweggenommen hätte’, und las es fortan zwei Monate lang mit ihren Nachbar:innen des großen gemeinschaftlichen Wohnprojekts, in dem sie mit Mann und kleiner Tochter lebt, abwechselnd auf dem Balkon. „Durch die Gitterstäbe auf die Welt hinauszusehen, macht die Welt sehr klar und deutlich.“ Im Zuge dessen ist ihr zugleich aber auch bewusst geworden, wie viel Grund sie hat, dankbar zu sein – „das war eine große Erfahrung“. Und haben am Anfang noch viele mitgemacht, war sie zum Schluss mit ihrem Mann allein, es weiterhin allabendlich zu rezitieren: „Einer muss den langen Atem haben und etwas durchschreiten.“
Vom Innenmaß der Dinge
Anknüpfend an die Vorstellung der spanischen Nonne Teresa von Avila (1515-1582), dass die menschliche Seele einer inneren Burg mit vielen Zimmern entspräche, habe sie „diese Zimmer schreibend abgeklopft“. Darunter ‚das Zimmer der Schmerzen, das der Biografie, der eigenen Verfasstheit genauso wie das Zimmer der äußeren Welt, etwa der Ökonomie, des Kapitals, aber auch das Zimmer der inneren und der äußeren Zeit’, um nur einige hier festzuhalten. Und wie von vielen zu vernehmen, erlebt sie den ersten Lockdown als ‚ganz großen Spiegel’ und Brennglas zugleich, in dem Abgründigkeit und Unvermögen menschlichen Verhaltens umso schärfer zutage treten. Zwingend macht es deutlich, wie grundlegend es zu hinterfragen ist. Eben dies tut Bodrožić im Zuge ihrer poetischen Bestandsaufnahme, einer Art Introspektion über den Zustand der Welt.
Was wir verpassen, wenn wir das Alte zurückersehnen
Angesichts gerade jetzt des Entstehens der Möglichkeit einer neuen Zukunft wird Bodrožićumso mehr bewusst, was sie nicht will, nämlich „dass die alte Mentalität der Ellenbogen und Gleichgültigkeit zurückkehrt“. Mehr als das Neue ängstigt sie das Alte. Ebenso wie allein der Gedanke daran, dass nach dem Lockdown ‚die Autos mit ihrem Krach und Gestank die Stadt wieder an sich reißen und die währenddessen erlebte Stille vergessen machen’, sie mit Trauer erfüllt. Wer nur das sucht, was er kennt, dem ist die Sicht neuer Wirklichkeitsbilder versperrt, eindrucksvoll dokumentiert von dem Begründer des alternativen Nobelpreises Jakob von Uexküll. Der fand, zu Gastbei einem Freund, täglich zum Mittagessen einen irdenen Wasserkrug an seinem Platz vor, den der Diener eines Tages zerbrach und ihm stattdessen eine Glaskaraffe hinstellte. Beim Essen suchte er nach dem Krug, sah die Glaskaraffe nicht. Erst nachdem man ihn ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht hatte, war er in der Lage, sie wahrzunehmen. Solange uns alte Denk- und Sehgewohnheiten nicht bewusst sind, hindern Sie uns nicht selten daran, das Neue, das längst in die Welt drängt, in Augenschein zu nehmen. „Vielleicht“, so Bodrožić, „ist der wichtigste Aspekt dabei, dass das, was vor uns erscheint, zunächst geistig ist ..., das uns seelische Fingerkuppen und geistige Sehkraft, Vorauskraft gleichermaßen abverlangt.“ Vorausgesetzt, wir sind offen dafür.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Otto Müller Verlag!

Buchtipp des Monats März 2021
© Hartmut Fanger
Menschenaffen – unsere Brüder
T.C. Boyle. "Sprich mit mir"
Roman, Hanser Verlag GmbH & Co KG, München 2021
Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren“
Das Ganze spielt in einer Zeit des großen Linguisten-streits über die Frage, inwieweit Affen sprechen lernen, sich zumindest in Gebärdensprache ausdrücken können. Laut dem bekannten, ganz realen Linguisten Chomsky war das Anfang der Siebziger der Forschung ein Dorn im Auge und wurde schlichtweg negiert – und dies, obwohl auf dem Gebiet schon einige Erfolge zu verzeichnen waren. Zumindest weisen die Versuchsreihen im Hinblick auf die Evolution verbaler Kommunikation stark darauf hin. So auch für die Protagonisten des Romans, Professor Guy Schermerhorn und seine Assistentin Aimiee. Der von ihnen betreute Schimpanse Sam erschien ihnen zu allem hin menschlich, galt gar als Familienmitglied. Finanziert wurde ihre Forschungsarbeit von Fördermitteln. Bis Big Boss Moncrieff in Erscheinung tritt, dem Sam gehört und der ihn wieder in Besitz nimmt, um ihn in einen Käfig zu sperren. Von nun an ist das Leben Sams ein völlig anderes, von Angst und Schmerz und ihn umgebender Dunkelheit geprägt. Bis wiederum Aimee ihn auf abenteuerliche Weise befreit. Doch dies Glück ist nicht von Dauer ...
Dabei wartet Boyle mit jeder Menge weiterer spektakulärer szenischer Darstelllungen auf. Sei es, wenn von der Teilnahme Sams an der Fernsehrateshow „Sag die Wahrheit“ oder von dessen Taufe die Rede ist. Frappierend nicht zuletzt der Kontrast zwischen einem liebevollen, empathischen Umgang mit dem Tier und der Tatsache, dass Tiere juristisch bis heute als Sache definiert werden.
Wir erleben einerseits den Boyle, den wir schon immer gern gelesen haben, mit witzigen Einfällen und farbigen Schilderungen, exzellenter Recherche und dem unverkennbar lockeren Schreibstil. Andererseits bringt er diesmal wirklich grausame Wahrheiten zur Sprache, indem er ungeschminkt aufzeigt, wie es Tieren ergeht, die zu Forschungszwecken missbraucht werden. Nichtsdestotrotz ein Muss für alle Boyle-Fans. Stehen am Ende – auch wenn dies traurig anmutet – doch Empathie gegenüber der Tierwelt, Umwelt-Engagement und Lust am Text im Vordergrund. Nachhaltig beeindruckend Boyles Versuch, sich in das Denken eines Schimpansen hineinzuversetzen.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Hanser Verlag!

Buchtipp des Monats
November-Dezember 2020
© Hartmut Fanger
Vom abgründigen Traum, ein Autor zu sein
Hilmar Klute: „OBERKAMPF“, Galiani Verlag, Berlin 2020
Ein nicht nur für die schreibende Zunft ungemein lesenswerter Roman. Denn mit dem Protagonisten Jonas Becker, seines Zeichens Schriftsteller, geht es darin stets auch um das Schreiben. Auserkoren hat er sich dazu Paris, Mekka der Künstlerseelen. Sein erklärtes Ziel, ein Buch über den von ihm verehrten Boehmien Richard Stein, gleichfalls Schriftsteller, zu schreiben. Dass seine Ankunft in Paris ausgerechnet mit dem Tag zusammenfällt, wo der Anschlag auf die französische Satirezeitung Charlie Hebdo verübt wird, macht ihn ungewollt zum Zeugen des damit von einem Tag auf den anderen über Paris verhängten Ausnahmezustands. Daran, wie sich das anfühlt, lässt uns der Autor hautnah teilhaben. Thema, das durch die drei jüngsten islamistischen Terroranschläge innerhalb weniger Wochen von trauriger Aktualität zeugt und damit zusätzlich an Brisanz gewinnt.
Spannend, dabei nicht wenig provokant, liest sich dann auch, wenn Klutes Protagonist im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung Verständnis für die Attentäter zeigt. So sieht er sich immer wieder die Gesichter der beiden Brüder an, die ‚den Spaßvögeln’ der Satire-Redaktion “das Hirn aus den Schädeln geschossen hatten“, und überlegt, inwieweit es sich dabei um „eiskalte Mörder“ handele, „feige Killer“, oder ob es „nicht im Gegenteil sehr viel Mut dazu“ bedurfte, „aus einer der elenden Hochhausburgen der Banlieues in die Stadt zu fahren, in eins der schönen, reichen und stolzen Viertel dort ...“ Sich dann zu Fuß auf den Weg zu machen, bis sie die Leute fanden, „die ihren Gott verhöhnt hatten“. Schließlich kommt Jonas Becker zu dem Schluss, dass das Ganze als „eine Mission, eine Kreuzritterfahrt, ein heiliger Krieg gegen die Ungläubigen ...“ [Leseprobe] angesehen werden könne.
Doch nicht nur die Ereignisse des Anschlags auf Charlie Hebdo beschäftigen den Protagonisten. Da ist zum einen die Liebe zu Christine, mit der er die Nächte verbringt, zum anderen sein Hauptanliegen, die Begegnung mit seinem Idol. Jenem sechsundachtzigjährigen Schriftsteller, Richard Stein, in Fachkreisen hoch angesehen, dessen Bücher jedoch keiner liest. Wider Erwarten führen die Gespräche zwischen Jonas und Stein für Ersteren jedoch zu einem Desaster. Zu Beginn noch hoffnungsvoll, so, wenn die Gespräche um die Bedeutung von Sprache, Gewalt, das gemeinsame Essen kreisen oder sie über Elias Canetti resümieren. Doch zunehmend reißt im Zuge dessen der so brillante wie exzentrische Stein, von unumstößlicher Autorität, das Zepter an sich. Und nach einem Disput, ob Jonas ein Interview oder eine Biographie plane, insistiert dieser, mit dem Verlag sei Letzteres abgemacht. Stein hingegen eröffnet ihm:
>„Dann sagen wir dem Verlag, dass wir beide hier, am Abend des schrecklichen Mordtages in Paris, im wunderbaren Restaurant Lao Siam, eine Änderung des Fahrplans beschlossen haben.“ Stein winkte dem Kellner zu, der sofort sein Lächeln anknipste und an den Tisch eilte.
„Bringen Sie uns doch eine Flasche Champagner, was haben Sie denn Gutes da, Monsieur?“ ... „Bollinger, très bien, magnifique, Kim on va prendre la bouteille.“
Mit einem triumphalen Lächeln zu Jonas: „Das wird in Ihrem Budget enthalten sein, oder?“<Leseprobe
Einmal mehr beweist der seit seinem Erfolgsdebut „Was dann nachher so schön fliegt“ bekannte Autor Hilmar Klute hier Sinn für Humor, womit er selbst schwerwiegenden Themen, wie einem Terroranschlag, so etwas wie Leichtigkeit abgewinnen kann.
Auf die Spitze getrieben wird das Verhältnis des ungleichen Paars, als Jonas und Stein sich zwischenzeitlich in Amerika aufhalten, wo sie in San Francisco Steins Sohn suchen und Jonas sich im Nebel verfährt.
>„Wir sind einmal durch San Francisco gefahren und an der anderen Seite wieder heraus!“, rief Stein. „Wie zwei Idioten. Herr Becker! Wie zwei Vollidioten!“< Leseprobe
Die zunehmenden Spannungen im Zuge besagter Reise kulminieren, indem Jonas Stein eröffnet, dass er kein Buch mehr über ihn schreiben könne, dass er ihm sein Konzept aus der Hand genommen und eigenmächtig geändert habe. Stein wiederum gibt ihm zu verstehen, dass er mit einer Biographie über ihn sowieso überfordert, sozusagen zum Scheitern verurteilt gewesen sei. Letztendlich entlarvt er ihn, indem er infrage stellt, dass er überhaupt seinetwegen nach Paris gekommen sei, sondern er in Wirklichkeit nur ‚sein bisheriges langweiliges Leben hätte wegwischen wollen’. ...
>Natürlich hatte Stein recht. Jonas hatte sich aus seinem alten Leben gestohlen und war ... in das Leben eines alten Mannes gezogen. Nicht in ein neues, eigenes Leben ... Und zur Strafe dafür saß er jetzt im Nebel der kalifornischen Provinz fest, weil Gott, der begnadete Trash-Regisseur, sie aus der Innenstadt von San-Francisco ins Nirgendwo gestoßen hatte.< Leseprobe
Mit Witz und Esprit werden hier Tiefen und Untiefen des Schriftstellerlebens austariert, Ausflüchte und Fluchten, Sinnsuche und Scheitern als unabdingbare Voraussetzung desselben erhellt.
Ein Buch, das den Leser nicht loslässt, ihn Seite für Seite fesselt und das er erst dann weglegt, wenn er es zu Ende gelesen hat.
Aber lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Galiani Verlag, Berlin!
Buchtipp des Monats Oktober-November 2020
Buchtipp des Monats Juni 2020

© Hartmut Fanger
Von Schreiben, Freundschaft
und einem Hund
Sigrid Nunez: „Der Freund“, Roman; aus dem Englischen von Anette Grube; Aufbau Verlag, Berlin 2020
Es geht um das, was uns bewegt. Um die Suche nach Sinn, nach einem erfüllten Dasein. Und es geht um das, was vor allem diejenigen berührt, die gerne schreiben, gerne lesen, kurz diejenigen, die eher in der Welt von Lektüren zuhause sind als im wirklichen Leben. Doch was hat das alles mit einem Hund zu tun. Dem wollen wir in dem hochkarätigen Buch von Sigrid Nunez „Der Freund“ nachgehen, für das sie 2018 den begehrten US-amerikanischen National Book Award erhielt und das sie über Nacht berühmt machte.
Apollo heißt der Hund, der dem Freund der Protagonistin gehörte und den dieser ihr nach seinem Selbstmord hinterlassen hat, was sie zunächst einmal vor ganz pragmatische Probleme stellt. Zum einen darf in der Wohnung kein Hund gehalten werden, zum anderen ist diese Wohnung, wie in New York üblich, mit ihren 45 Quadratmetern viel zu klein, erst recht für eine so riesenhafte Dogge wie Apollo.
Was ist es, neben seiner enormen Größe und Liebeswürdigkeit, was uns an diesem Tier in den Bann zieht? Da ist zum einen, dass es der Hund eines Schriftstellers und Kollegen, in einer kurzen Episode auch mal Lovers war und nun zum Freund der Ich-Erzählerin und Dozentin für Create Writing avanciert. Imgrunde hat sich für die Dogge also gar nicht so viel verändert. Der Protagonistin hingegen eröffnet es die Möglichkeit, im gemeinsamen Trauern mit dem Hund die Beziehung zu dem toten Freund fortzuleben. Und darin ging es, neben Schreiben und Literatur, um fast nichts anderes als um Frauen. Wozu sich ihm als Dozent für Creative Writing reichlich Gelegenheit bot. Und so bewahrheitet sich der lapidare, bereits zum Klischee geronnene Spruch, „Wer schreibt, der bleibt“, gleich auf zwei Ebenen. Zum einen durch den Hund, in dem für die Protagonistin sein einstiges Herrchen fortlebt, zum anderen in der Arbeit der Dozentin und Autorin, die im Zuge dessen mit dem Schreiben etwas Bleibendes zu hinterlassen vermag.
Dabei liest sich das Ganze, elegant formuliert, ausgesprochen leicht. Und dies, obwohl es den Leser zugleich herausfordert, in die Tiefen der Literatur einzutauchen, wenn sie den Gedanken W.H. Audens, Samuel Becketts, Gustave Flauberts, Milan Kunderas, Georges Simenons oder Christa Wolfs nachgeht. Und es hat natürlich auch etwas so Heiteres wie Anrührendes, wenn die an Depressionen leidende Dogge lächelt, sobald ihr Rilke vorgelesen wird, oder bei Knausgärd ihre Zuneigung kundtut.
Der in zwölf Teile gegliederte Roman, auf den dieses Genre vielleicht gar nicht zutrifft, der vielmehr den Verdacht provoziert, es könnte sich auch um einen autobiographischen Text handeln, spielt auf 235 Seiten die Klaviatur der großen Themen der Literatur durch: Tod, Liebe und Sinnsuche. Spannend, heiter, traurig, wie das Leben selbst, zugleich zutiefst wahrhaftig.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Aufbau Verlag, Berlin 2020 Archiv
Buchtipp des Monats Mai 2020

© Hartmut. Fanger:
Meisterhafte Präzision
William Trevor: „Letzte Erzählungen“, aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser, Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2020.
Wer „Letzte Erzählungen“ des 2002 von Elisabeth II zum Ehrenritter geschlagenen und 2016 verstorbenen irischen Schriftstellers William Trevor in Händen hält, dem wird sehr schnell klar, dass es sich hierbei um ein Werk von Rang handelt. Zehn meisterhafte Erzählungen – ein literarisches Kleinod. Nahezu jeder Satz von existentieller Dimension. Dicht geschrieben, den Leser fordernd, zugleich mitreißend und bis ins kleinste Detail genau. Darüber hinaus anrührend und zum Nachdenken animierend.
Vergänglichkeit das Stichwort. Immer wieder ist von Endlichkeit, von Einsamkeit und Tod die Rede. Einfühlsam und mit Empathie führt Trevor seine Figuren vor Augen. Melancholisch der Grundtenor. „Mitten im Leben sind mit dem Tod umfangen ...“ tönt es von Orgel und Chor während der kirchlichen Trauerfeier in „Das unbekannte Mädchen“, was zugleich Leitsatz vieler dieser Erzählungen sein könnte.
Dabei sind in den Haupterzählstrang stets Nebenhandlungen eingebettet, die sich an bestimmten Punkten, wie nach einem geheimen Strickmuster, wieder zusammenfinden. So zum Beispiel das Treffen zweier Frauen „Im Caffé Daria“, wo nach und nach herauskommt, dass sie ein und denselben Mann geliebt haben, von dem sie aus ihrer Erinnerung heraus sprechen. Eine Geschichte, in der es insbesondere um ein Haus, Schicksal, um Freundschaft, Liebe, Verzweiflung und um besagten Tod geht.
In „Mrs Crasthorpe“ wechseln sich zwei Erzählperspektiven ab. Da ist Etheridge, der seine Frau verloren hat und dies nicht fassen und akzeptieren kann. Dann die Titelheldin Mrs Crasthorpe, die in Kontrast hierzu die Rolle der ‚lustigen Witwe’ bevorzugt. Letzteres ist Etheridge natürlich zuwider. Die daraus entstehende Spannung beherrscht den gesamten Text, mündet an einer Stelle in den für das Ganze paradigmatischen Satz: „Ihre Avancen wurden von seinem anhaltenden Zorn über die gleichgültige Gier des Todes überlagert und kaum wahrgenommen.“
Paradebeispiel für mit Raffinement verschlungene Erzählperspektiven ist „Mr. Ravenswood“, wo sich besagter Titelheld mit der ihm sympathischen Bankangestellten im Restaurant einfindet und im Gespräch herauskommt, dass er vornehmlich von seiner Frau spricht, die bei einem von ihm verschuldeten Verkehrsunfall gestorben ist. Erzählt wird dies jedoch nicht aus der Perspektive des Titelhelden, sondern von der Bankangestellten in einem Moment, wo sich sie sich, im Park ein Sandwich verzehrend, eben daran erinnert.
Und doch sind die Geschichten bei allem Todesschwangeren zugleich prall gefüllt von Leben, treffen sich die Menschen in einer so hektischen Großstadt wie London auf Straßen, Plätzen und in gut besuchten Cafés. Das Ganze kunstvoll arrangiert und gewürzt mit jeder Menge sinnlicher Momente. So zum Beispiel, wenn in das ‚Caffé Daria Geschäftsleute hereinströmen, um das Frühstück nachzuholen, Freunde und Stammgäste nach Zeitungen greifen, die Croissants berühmt sind, das mittägliche Rührei mit geräuchertem Lachs als das beste von London gilt ...’
Bezeichnend, dass sich jede Seite in der großartigen Übersetzung von Hans-Christian Oeser gleich mehrfach zu lesen lohnt. Immer wieder kann man auf Entdeckungen stoßen, die einem beim ersten Lesen entgangen waren. Und immer wieder gibt es insofern auch Überraschungen. So revidiert der oben bereits erwähnte Etheridge am Ende seine Meinung von Mrs Catherope und versucht ‚das Rätsel’ um ihre Person zu ergründen: „Er ehrte das Geheimnis einer lästigen Frau und sorgte dafür, dass es gewahrt blieb.“
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2020
Siehe auch Buchtipp des Monats Dezember 2015:
William Trevor: "Ein Traum von Schmetterlingen" und Archiv
Buchtipp des Monats April - Mai 2020

© Erna R. Fanger
Präsenz der Poesie
Pascal Mercier „Das Gewicht der Worte“, Carl Hanser Verlag,München 2020.
Hier war sich das Feuilleton landauf landab einig, und das nicht ohne Häme: zu redundant, das Personal, lauter Feingeister, zu blass, Bildungsbürgertum ... etc. Zugegeben, der Plot wirkt konstruiert, die Figuren in ihrer ethisch-moralischen Überhöhung unfreiwillig überzeichnet.
Warum wir nichtsdestotrotz eine Lanze brechen für das Werk, ist die Begeisterung für Sprache, die es transportiert – ein glühendes Plädoyer für ‚das Gewicht der Worte’, das trägt. Und es ist das Vergnügen am Sinnieren über Wahrnehmung und Perspektiven, über Lust und Last, die Schreibende anstachelt, die Welt auf ihre ganz eigene Weise immer wieder von neuem durchzubuchstabieren. Und es mag sich bei Lesern und Schreibenden jenseits der Hoheit des Literaturbetriebs ähnlich verhalten wie zwischen Laien- und professionellem Chor. Letzterer mag Ersteren an Perfektion übertreffen, aber die Liebe zum Singen, ohne jeden Sachzwang, wie dem Laienchor substanziell eigen, diese hochtrabende Freude, transportiert einen Zauber, der nicht nur nicht zu verachten, sondern mitunter durchaus auch nicht zu überbieten ist. Und es sind immer wieder Sätze wie dieser: „Jetzt öffnete Kenneth Burke im Nachbarhaus ein Fenster, blieb stehen und zündete eine Zigarette an; auch ihre glühende Spitze hatte, wie die Straßenlaternen, im Nebel einen feinen milchigen Hof“Leseprobe, die uns in ihrer bestechenden Präzision und poetischen Präsenz in den Bann ziehen.
Von Kind an von Sprachen fasziniert, lernt Protagonist Simon Leyland alle, die rund um das Mittelmeer gesprochen werden, heiratet schließlich Lydia, eine Verlegertochter aus Triest, und übernimmt später zusammen mit ihr den Verlag, was den in London ansässigen Briten nach Italien verschlägt. Sie haben eine Tochter, die eigentlich Ärztin werden will, jedoch zunehmend vom Gesundheitssystem enttäuscht ist und schließlich Abstand davon nimmt. Zu Beginn des Romans, 24 Jahre später, nachdem er London verlassen hatte, kehrt er dorthin zurück. Lydia ist inzwischen verstorben. Den Verlag hatte er zunächst alleine betrieben. Bis er ihn in einer Art Kurzschlusshandlung angesichts einer tödlichen Diagnose, die sich alsbald als Irrtum herausstellen sollte, kurzerhand verkauft hat. Ein Onkel, Professor für orientalische Sprachen, hat ihm sein Haus nahe London vererbt, und mit Kenneth Burke vom Nachbarhaus, der sich in seinen letzten Jahren um diesen gekümmert, alles für ihn geregelt hat, zugleich einen Freund.
An dieser Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt setzt die Erzählung ein. Dabei kreisen seine Gedanken um die Frage, was er aus der Zeit seines Lebens gemacht habe: „Es war ein Dunkel nach dem Ende eines Lebens, ein Dunkel, in dem die Zeit nicht mehr floss. Er würde nachher überall Licht machen und sie von neuem zum Fließen bringen.“LeseprobeDabei werden nicht nur die äußeren Stationen Leylands reflektiert, sondern zugleich neue Perspektiven entworfen. Denn hat Leyland sich bislang nur in Briefen an seine verstorbene Ehefrau Lydia schreibend Ausdruck verschafft, denkt er jetzt daran, weiterzugehen und selbst Erzählungen zu schreiben. Begleitet ist dieser Prozess von überbordendem Gedankenreichtum über die geheimnisvoll anmutende, von Worten ausgehende Schwingung, von ihrer Macht, die ebenso zu verschleiern und zu verdunkeln, als zu erhellen in Begriff steht:
"Wenn man in Gegenwart anderer über sich spricht, sagt man nie genau das, was man eigentlich sagen möchte: Selbst wenn man sich dessen nicht bewusst ist, hemmt einen die Rücksicht, entweder die Rücksicht auf die Wirkung der Worte in den anderen, oder die Rücksicht auf die Art und Weise, wie man für die anderen durch diese Worte erscheinen würde. Und nachher hat man, statt mit sich selbst in der Klarheit einen Fortschritt gemacht zu haben, mit diesen Wirkungen bei den anderen zu kämpfen".Leseprobe,
Stellen wie diese, wo Mercier den Worten und ihrer Wirkmächtigkeit auf den Grund geht, bergen für den literatur- und sprachaffinen Leser so manchen Schatz, den es in diesem Werk, allerhand Unkenrufen zum Trotz, mannigfaltig zu heben gibt.
"Und nun war ja etwas Neues dazugekommen: das Schreiben, die Arbeit an der eigenen Phantasie und die Suche nach den eigenen Worten, der eigenen Stimme. Das war etwas, was eine eigene Zukunft in sich trug. Wie lange würde sie dauern?"Leseprobe
.Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Carl Hanser Verlag, München 2020 Zum Archiv
Buchtipp des Monats März - April 2020
© Hartmut Fanger:
Vier Freundinnen und ein Mann, der alles verändert

Julia Holbe: „UNSERE GLÜCKLICHEN TAGE“, Penguin Verlag, München 2020
Es sind die Szenen einer innigen Freundschaft zwischen vier Frauen, die dieses Debut der Luxemburger Autorin und einstigen Lektorin des renommierten S. Fischer Verlages so lesenswert machen. Authentisch führt Julia Holbe in „UNSERE GLÜCKLICHEN TAGE“ die alljährlich sich wiederholenden, unbeschwerten Sommerferientage an der französischen Atlantikküste vor Augen. Ein Meer voller Träume, Gemeinsamkeit, gegenseitigem Verständnis und Zusammenhalt. Urlaube, wie sie im wahrsten Sinne des Wortes im Buche stehen. Lange Abende am Strand, gutes Essen und so manches Glas Wein, das man genießt. Aber auch von Verrat und Tod und Trennung ist die Rede.
Neben anschaulichen Naturbeschreibungen ist es vornehmlich die aus den Fugen zu geraten drohende Gefühlswelt der Protagonistin und Ich-Erzählerin Elsa, die den Leser in den Bann ziehen. Sie verliebt sich ausgerechnet in Sean, den einzigen Mann in der Runde. Sogar ihre Heimat würde sie für ihn verlassen und für immer mit ihm nach Irland ziehen. Jener geheimnisvolle Sean, der kommt und geht und unverhofft wieder in Erscheinung tritt, um im nächsten Moment schon wieder zu verschwinden. Die Begegnung mit ihm hat für Elsa alles auf den Kopf gestellt, in ihr eine ‚schreckliche, entsetzliche Sehnsucht’ geweckt, am Ende das Gefühl, ‚nichts mehr im Griff’ zu haben'.
So berührend wie treffend der grundlegend melancholische Tenor, der sich in den tragischen Handlungsverlauf einschreibt. Und es ist die Magie, die dem Ganzen anhaftet, sei es der Landschaft, dem Meer und dem Sommerhimmel, sei es dem Verliebtsein, was wiederum "Lust am Text“ evoziert. So ist Elsa der Meinung, dass Sean ‚ohne Zweifel über magische Fähigkeiten’ verfügt oder der Sommer für sie‚ seit ihrer Kindheit etwas Magisches gewesen sei’.
Geschickt hält die Autorin den Leser bei der Stange, indem sie vor allem in dem einen wichtigen Punkt über weite Strecken nur in Andeutungen verfährt: Es muss etwas Gravierendes, alles infrage Stellendes in der Beziehung zwischen Elsa und Sean vorgefallen sein. Doch was, das soll an dieser Stelle nicht verraten werden.
Ein Buch, das einerseits in Ferienstimmung versetzt, andererseits zum Nachdenken über die Phänomene Liebe und Tod anregt.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Buchtipp des Monats März 2020
Buchtipp des Monats März 2020

© Hartmut Fanger www.schreibfertig.com: Geliebte Helden ...
Gudrun Hammer: "Lieberkühn", edition wohlwill, Hamburg 2017
Bekanntermaßen haben es Kurzgeschichten, Storys oder Erzählungen nicht gerade leicht, an den Leser gebracht zu werden. Ein Phänomen, zumal es sich dabei in der Regel um kleine Kunstwerke handelt, die dem Autor einiges Knowhow abverlangen. Nicht zuletzt geht es darum, mit möglichst wenigen Worten möglichst viel auszusagen und dabei beredt zu verschweigen, was die Fantasie des Lesers umso mehr anregt, diesen aktiv ins Geschehen zu involvieren.
Gudrun Hammer beweist in ihrem 13 Geschichten und 187 Seiten umfassenden Band „Lieberkühn“, dass sie ihr Metier beherrscht. Und sie liebt ihre Figuren. Sei es, wenn in „Anettes Reich“ vom Atelier einer Malerin außergewöhnlichen Charakters die Rede ist, oder in „Schuldlos“ davon berichtet wird, wie Marion Giese ihre Einstellung zu dem verstorbenen Chef und Psychiater Dr. Broszat auf ihre ganz eigene Weise nahebringt. Gewagt dann am Schluss der Teil über „Die Ängste des Seemanns vor dem Land“, was allein schon von der Namensgebung her des Kapitäns, „Hammer“, autobiographische Züge erwarten lässt.
Und immer wieder entführt uns die Autorin in die Welt der Wörter und Buchstaben. Sei es in der Titelgeschichte „Lieberkühn“, wo sich die Protagonistin Beatrice im Zuge der Untreue und Unehrlichkeit ihres Partners dessen Briefe im wahrsten Sinne des Wortes einverleibt. Oder Hans, dem angesichts der Lektüre des Manuskriptes seiner schreibwütigen Partnerin Greta im Umfang von neunhundertundsechs Seiten der Kopf schwirrt und dem die Buchstaben vor seinen Augen tanzen. Greta wiederum, die, sich ihren Traum erfüllend, völlig in ihren Geschichten und Romanen aufgeht, selbst des Nachts im Traum mit ihren Figuren spricht und ihn am Tage kaum mehr wiedererkennt. Überdies verleiht dem Ganzen manch’ literarische Anspielungen Substanz. So etwa in „Die Suche“, wo der in einer Krise steckende, weithin bekannte Erfolgsautor Martin W. die Hamburger Bücherszene nervt. Oder gleich zu Beginn, wo nicht ohne ironischen Tenor Arthur Schnitzlers „Der Reigen“ ins Spiel und in Zusammenhang mit den dort um den Beischlaf konstruierten Dialogen gebracht wird. Alles in allem ein Lesevergnügen par excellence, raffiniert eingefädelt und stets mit Augenzwinkern.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt der edition wohlwill
Siehe auch Poet's Gallery
Datei als Download im Archiv
Buchtipp des Monats November - Dezember 2019

© Erna R. Fanger:
Am Anfang steht das Anderssein
Ilma Rakusa: „Mein Alphabet“, Literaturverlag Droschl GmbH, Graz 2019
A wie „Anders“ steht in diesem poetischen Alphabet nicht nur für den Anfang, sondern scheint zugleich Programm zu sein. Denn das ist eine der ersten Erfahrungen der Autorin als Schulkind, festgehalten in diesem sehr persönlichen Buch: Sie ist anders als ihre Mitschülerinnen. Man zeigt mit dem Finger auf sie, grenzt sie aus. Sie hingegen bleibt „draußen am Zaun“. Dort lernt sie, was wesentlich für ihr späteres Leben als Schriftstellerin sein wird: zu beobachten, in Berührung mit der heilenden Kraft der Natur zu kommen ebenso wie mit ihren Träumen und ihrer Fantasie. Allesamt erweisen sie sich als tragende Kraft durch Schatten und Licht, von der die hier unter besagtem Motto versammelten Kurzprosatexte und Gedichte zeugen.
Tauchen wir ein in die Lektüre, beginnt, jenseits von Hektik und Aufgeregtheit, die derzeit den öffentlichen Diskurs dominieren, eine andere Zeitrechnung. Nämlich die des Kairos, Zeit des Eingedenkens, statt des Kronos‘, des chronologischen, linearen Aspekts der fortschreitenden Zeit. Und eine eigentümliche, ja beinahe schon Sucht erzeugende Ruhe geht von den poetischen Miniaturen des Rakusaschen Kosmos‘ aus, getragen von einer Fülle an Referenzen an Literaturen und ihre Autoren, an bildende Kunst oder die Entdeckung auf Reisen unterschiedlicher Kulturen, an Naturbeobachtungen. Sei es die Erhabenheit ehrfurchtgebietender Berge, sei es die eher ängstigende Wildheit von ‚Atlantik, Pazifik und anderer Ozeane‘ im Gegensatz zum geliebten Mittelmeer der Kindheit in und um Triest.
Und wer einen Zipfel vom Paradies erhaschen will, möge der Lektüre des G wie Granatapfel folgen. Hier liegt die Schönheit besagter Frucht weniger im Auge des Betrachters als vielmehr an der sprachlichen wie faktischen Präzision, mit der Rakusa sie uns nahebringt. Sei es im Hinblick auf die changierende Farbvielfalt, dem Strahlen, „sein Kelchblatt wie ein Krönchen hochreckend“, oder wenn in seinen diversen ,Kammern mit rubinrot leuchtenden Perlen sich ein Schatzkästchen auftut‘. Wobei eine einzelne Frucht bis zu 400 Samen birgt – ‚an ein Wunder grenzend‘. Und wer einmal aus den Augen Rakusas Malewitschs „Schwarzes Quadrat auf weißem Grund« (1915)“ in Augenschein genommen hat, wird, wie Rakusa selbst, eines ‚Erweckungserlebnisses‘ teilhaftig, von dem sie uns wissen lässt: „… es initiierte mich in die gegenstandslose Malerei.“ Wobei die religiöse Diktion kein Zufall ist, vielmehr erfahren wir, dass dieses Schwarz, ‚in seiner Vieldeutigkeit vibrierend, für Malewitsch selbst Ikone war, die er wie ein Heiligenbild in seinem Haus aufhängte‘, wo man seinem ‚dynamischen Schweigen, seinem Rhythmus und seiner Erregung‘ huldigen konnte.
Den Schluss bilden, dem Z gemäß, „Zwetajewa“ und „Zaun“. Marina Zwetajewa (1892-1941), die große russische Dichterin, Dramatikerin und Essayistin. „Fast bin ich mit ihr befreundet, so viele Jahre habe ich mich lesend und übersetzend mit ihr beschäftigt, sie in imaginären Gesprächen um Rat gefragt.“ Schwester im Geiste Rakusas, zugleich Art Spiegelfigur. Zu ihr entfaltet sich allein im Zuge der Herausgabe und Übersetzung ihrer Werke im Suhrkamp Verlag eine so innige Beziehung, dass man die beiden Poetinnen vor dem geistigen Auge zusammen sieht wie zwei eng miteinander vertraute Freundinnen:
»Marina!« Sie schaut mich an. Wachsam. Hinter der Wachsam-
keit erkenne ich tiefe Müdigkeit. Aber es kommt keine Klage. Nur
der Satz, sie müsse noch auf den Markt. »Gehen wir zusammen.«
Last but not least „Zaun“, womit sich der Kreis schließt: „Sie hingegen bleibt „draußen am Zaun“ (siehe oben). Wobei sie zwischen dem poetischen Holzzaun und dem unerbittlichen aus Metall unterscheidet, wo kein Geflüchteter mehr durchkommt. Dem wiederum setzt sie ihr ganz eigenes Plädoyer entgegen: „„Ich plädiere für löchrige Zäune, die symbolisch einhegen. Wie ein zärtlicher Wink. Und dich zum Schauen einladen. Komm, komm …“
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Literaturerlag Droschl in Graz

Buchtipp des Monats Juli 2019
© Hartmut Fanger
Von der abgründigen Schönheit der Kunst
David Foenkinos: „Die Frau im Musée d’Orsay“, Penguin-Verlag, München 2019, aus dem Französischen von Christian Kolb.
Von Beginn an lebt das Buch von dem Geheimnis umwobenen Protagonisten, Professor Antoine Duris. Wie kommt es, dass er plötzlich seinen hochdotierten Job an der Hochschule der Schönen Künste von Lyon kündigt und in Paris als Wärter im Musée d’Orsay ein neues Leben beginnt? Warum würde er am liebsten ganz verschwinden? Im digitalen Zeitalter so gut wie unmöglich. Mit Spannung verfolgt der Leser all die Hintergründe, die nach und nach zutage treten. Erzählt in diesem beschwingt leichten Tenor, der uns in französischen Lektüren stets bezaubert, bei Foenkinos allerdings bisweilen in den Kitsch driftet und sprachlich nicht immer frei von Banalitäten ist. Nichtdestotrotz gelingt es ihm, den Leser tief zu berühren angesichts des tragischen Schicksals der jungen talentierten Schülerin des Professors und Malerin Camille. Einst von Kunstlehrer Yves, dem Mann der besten Freundin ihrer Mutter, vergewaltigt und zum Schweigen erpresst. Doch der Roman zeigt auch, dass die schönen Künste eine heilende Wirkung auf die Seele haben können. So findet Duris schließlich durch die Bekanntschaft von Camille und deren Bilder wieder zu seiner eigentlichen Passion als Professor zurück. Damit steht der Liebe zu Museumsdirektorin Mathilde Mattel nichts mehr im Wege. Seine ehemalige Frau hingegen erwartet ein Kind von einem anderen.
Spannend im Übrigen, wenn Duris zwar unerkannt bleiben will, sich dann aber als Wärter dazu hinreißen lässt, einen Museumsführer vor versammeltem Publikum zu berichtigen. Unkonventionell arrangiert überdies, wie aus der Beziehung zu Museumsdirektorin Mathilde langsam Zuneigung erwächst, nachdem es zuvor alles andere den Anschein hat. Sinnfällig das Figurengeflecht rund um Camille. Mit Ausnahme ihrer Psychologin weiß keiner aus ihrem Umfeld, was ihr eigentlich widerfahren ist. Dies mag nicht zuletzt auf die Isolation des Individuums im Digitalen Zeitalter verweisen, wo der Mensch zwar gläsern ist, zugleich aber ein Mangel an tragfähigen Beziehungen zu herrschen scheint, was die Katastrophe, auf die Camille zusteuert, vielleicht hätte verhindern können.
Eine leichte, unterhaltsame Sommerlektüre, in der das Dunkel des Bösen mit dem Licht der Schönen Künsten treffend kontrastiert.
Aber: Lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Penguin-Verlag
Datei als Download im Archiv
Siehe auch Arie Anwar "Kreise ziehen"

Buchtipp des Monats Mai 2019
© Erna R. Fanger
Herkunft – Süß-bittere Zufälle
Saša Stanišić: “Herkunft“, Luchterhand Literatur Verlag, München 2019
Vielsagend eine von vielen Definitionen Stanišićs von Herkunft, zum Besten gegeben auf seiner so gut wie ausverkauften Lesung im Hamburger Thalia Theater am 17. März 2019: eine Art überschätztes Kostüm.‚Kostüm’, abgeleitet vom lateinischen „consuetudo“, dt.: Gewohnheit, Herkommen, Sitte. Herkunft meint demnach das, was wir gewohnt sind, wowir herkommen, welche Sitten wir mitbekommen haben. Doch Stanišić greift tiefer, stellt Fragen und infrage: „Provenienz der Eltern? Gene, Ahnen, Dialekt? ... Eine Art Kostüm, das man ewig tragen soll, nachdem es einem übergestülpt worden ist.“
Die zentralen, hier ins Spiel gebrachten realen Orte, die die Herkunft des Ich-Erzählers ausmachen: 1. Višegrad, Klein- und Geburtsstadt Stanišićs; 2. Oskoruša, vergessenes Dorf in den Bergen mit überalterten Bewohnern, woher einst sein Großvater stammte, jedoch mit einem bemerkenswerten Friedhof, wo jedes zweite Kreuz mit dem Namen des Autors, Stanišić, versehen ist, und die Toten, auf deren Gräbern man Schnaps trinkt und Picknick macht, eine wunderbare Aussicht genießen; 3. Heidelberg, erste Station nach der Flucht aus Bosnien-Herzegowina, wo der Ich-Erzähler seine Jugend verbringt, wo ein Lehrer seine Gedichte in jugoslawischer Sprache liest und ihn ermutigt, auf Deutsch zu schreiben, und damit offenbar den Grundstein für seine Schriftstellerkarriere gelegt hat. Doch was sind Orte im geographischem Sinne im Gegensatz zu den inneren – im Kosmos von Stanišić ebenso Facetten von Herkunft wie Erinnerung und Fiktion, das was uns die Fantasie zuspielt.
Herkunft, zugleich einAspekt von Heimat und allein schon insofern überschätzt, als es das ist, woran der Mensch sich klammert. Als solches muss es Konstrukt bleiben, weil es der Wirklichkeit – in stetigem Wandel begriffen – nicht standhält.
Der Kern von Herkunft wiederum ist das Land der Kindheit. Bei Stanišić steht dafür in erster Linie Großmutter Kristina – der Großvater bleibt Leerstelle. Später wird er in Schuhkartons nach ihm suchen und in alten Schubladen, wo die Großmutter Dokumente von ihm aufbewahrt. Und in „einem Gläschen Cognac“, einem Cognac des Großvaters, älter als der Ich-Erzähler. Die Großmutter hingegen scheint immer präsent und ist in einer herzzerreißenden Szene auch Ausgangspunkt von „Herkunft“, zugleich Anlass einer umfassende Spurensuche in eigener Sache. Da hat sie das Vergessen bereits eingeholt, da weiß sie schon nicht mehr, wer sie ist. Mit dem Begräbnis der Großmutter endet der Roman nach mehreren Anläufen, überhaupt zu einem Ende zu gelangen. Denn „Herkunft“ ist ein Anschreiben gegen das Aufhören, gegen das Schwinden der Erinnerung und letzten Endes gegen den Tod, immer und immer wieder, gegen das Aufhören von Geschichten. Wie auch ‚die Lücken der Großmutter mit Geschichten gefüttert werden’, wie Stanišić seinem Hamburger Lese-Publikum verrät.
Und in dem Maße, wie die Großmutter ihre Erinnerungen verliert, klaubt der Ich-Erzähler sie offenbar wieder zusammen. In einem Wettlauf mit der Zeit, die über alles hinwegzufegen scheint. Nicht zuletzt, und das ist das Tragische, über die Beziehung zu der geliebten Großmutter. Sie sind sich fremd geworden im Zuge der räumlichen Trennung des Exils. Unvermeidlich. Die Brücke zwischen den Generationen scheint im Extremfall von Krieg und Flucht schneller aufgebraucht. Familienbande zerbrechen. Und man wird das Gefühl nicht los, als verlöre in gleichem Maße, wie sich dieser Bruch sich vollzieht, wiederum die Großmutter ihr Gedächtnis. Szenen aus Dekaden zuvor, wie einst das Warten auf ihren Mann Pero, wiederholen sich im Jahr 2018, die zeitliche Differenz dazwischen aufgehoben.
Aber das sind nur Grundpfeiler dieses genial organisierten Erzähl-Mosaiks, das uns Wirklichkeit vielfach widerspiegelt. Nicht linear, chronologisch, umkreist Stanišić vielmehr die Gegenstände des Erzählens immer wieder aus unterschiedlichen Blickwinkeln, durchwirkt von Erinnerungssplittern, Fragen, magischen Momenten und Geheimnis. Kein Roman im herkömmlichen Sinn also, verweben sich hier Erinnerung und Erfindung mit Zeit- und Migrationsgeschichte, Reflexion und Assoziationen. Auf die Frage hin der Großmutter, ob „Herkunft“ „ein Buch über uns“ sei, antwortet der Autor etwa:
„Fiktion (...) sagte ich, bilde eine eigene Welt, statt unsere abzubilden, und die hier (...) sei eine Welt, in der Flüsse sprechen und Urgroßeltern ewig lebten. Fiktion (...) sagte ich, ist ein offenes System aus Erfindung, Wahrnehmung und Erinnerung, das sich am wirklich Geschehenen reibt.“
Aber: Lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Luchterhand Literatur Verlag, München!

Buchtipp des Monats März 2019
© Erna R. Fanger
Vom Aufstieg und Fall eines Gurus
T. C. Boyle: “Das Licht“, aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Hanser Verlag, München 2019.
Mit „Das Licht“ knüpft T.C. Boyle an frühere Romane an, in deren Zentrum eine Kultfigur steht, etwa Kellog oder Alfred Kinsey. Und wie immer geht es bei diesem Setting darum, wie nah die jeweiligen „Jünger“ dem verehrten Guru stehen, und damit um das Gerangel, zum inneren Kreis zu zählen. Letzteres ist auch das Ansinnen des Protagonisten Fitz, einer der Harvard-Doktoranden um den legendären Drogenprofessor Timothy Leary im Fach Psychologie. Der hat mit Drogen zunächst mal so gar nichts am Hut. Vielmehr hegt er die typischen Karriereträume eines Spießers. Schließlich hat er Frau und Kind. So sind ihm die ‚Sessions’ seiner Studienkollegen, wo es statt um die Erforschung von harten Fakten um Selbstversuche im Zuge von Drogentrips geht, nicht nur fremd, sondern äußerst suspekt. Und er nimmt das lediglich aus Furcht auf sich, sonst womöglich seinen Platz im ‚Inner Circle’ einzubüßen.
Doch schnell ist er infiziert vom Sehnsuchtsvirus der Bewusstseinserweiterung, der die Ränder einer ganzen Generation erfasst hat, die Ränder, von denen jedoch immer schon die entscheidenden Impulse ausgegangen sind: der Sehnsucht, die Ketten von Materialismus und Spießbürgertum zu sprengen, wie sie nach der einschneidenden Erfahrung des Zweiten Weltkriegs für Europa und die USA prägend waren. Und so sollte nach seiner Entdeckung 1943 seitens des Schweizer Chemikers Albert Hof LSD zu Beginn der 60er Jahre in den USA bahnbrechend das Feld der Psychologie und von dort aus die Welt revolutionieren. Es galt am Ende gar als der direkte Weg zu authentischer Gotteserfahrung, mystischer Verklärung in der Gemeinschaft Gleichgesinnter und markierte die Geburt der Hippiebewegung.
T.C. Boyle, selbst drogenerfahren und eben dieser Generation zugehörig, schildert das Ganze aus der Perspektive des Kenners der Szene, der erhellende Blick auf die Ereignisse von damals von wohlwollender Distanz. Der einst bissige Sarkasmus, abgelöst von feiner Ironie. Dabei zeigt er die Figuren dem Stand ihres sozialen und entwicklungspsychologischen Kontexts gemäß, ohne sie zu diskreditieren. Was von ihnen zu halten sei, wird jeder Leser für sich entscheiden. Ein unaufgeregter Blick, getragen von nachsichtigem Humor für die Irrwege, die hier beschritten werden. Irrwege, wie sie auch von anderen Communitys der 60er Jahre, etwa den Bhagwan-Anhängern oder der Mühl-Kommune, bekannt sind, und die augenscheinlich allesamt zum Scheitern verurteilt waren.
So artet der hoffnungsvolle Aufbruch in ein neues Zeitalter der Bewusstseinserweiterung – statt sorgsamer Erforschung und Dokumentation der Experimente mit LSD-Trips – aus in Partyexzesse. Exemplarisch für das Scheitern der Bewegung Doktorand Fitz, dem im Zuge des Prozesses zwischen Aufstieg und Fall der Community nicht nur seine Dissertation aus dem Blickfeld gerät, sondern auch Frau und Kind, während er nach einem experimentellen Partnertausch der 19 Jahre jüngeren Lori verfällt. Ganz zu schweigen von Guru Leary, der das hehr angelegte Experiment wegen eines Models verlässt, dem er wiederum verfallen ist.
Die Rezensionen und Meinungen über Machart und Stil überschlagen sich – von unumwundener Bewunderung über manch Häme des deutschen Feuilletons, wie es im Buche steht. Was die Faszination von „Das Licht“ eigentlich ausmachen mag, ist, dass darin eine Menschheitssehnsucht verhandelt wird, die noch lange nicht abgegolten scheint und in dem ernsthaften Versuch besteht, wenn nicht das Paradies auf Erden zu installieren, so diese doch zu einem Ort zu machen, der allen Bewohnern ein würdiges Leben gewährt. Diese Vision, der 68er-Generation zugeschrieben und von dieser einst mit Macht vorangetrieben, ist offenbar aus dem Menschheitsgedächtnis nicht zu tilgen. Auch wenn Unkenrufe aus den Reihen der Etablierten uns dies unablässig – gleichwohl mit Macht – auszureden versuchen. Umso berauschender, diese Aufbrüche in Boyles fiktiver Chronik der Ereignisse jetzt nacherleben zu können und sie einmal mehr aufflammen zu lassen.
Dass die LSD-Forschung, nachdem sie lange ein Schattendasein führte, indessen neue Wege einschlägt und evidente Erfolge in der Arbeit mit Sterbenden erzielt hat ebenso wie in der Behandlung von Suchtkrankheiten und Depressionen, bezeugt einmal mehr, dass Boyle hier nur eine Etappe auf einem Weg nachgezeichnet hat, der noch lange nicht zu Ende sein mag. Nicht verschwiegen sei an dieser Stelle das herausragende Werk des exzellenten Journalistik-Professors Michael Pollan, „Verändere Dein Bewusstsein“, Antje Kunstmann-Verlag, das im Übrigen nahezu zeitgleich mit Boyles „Das Licht“ auf dem deutschen Büchermarkt Furore macht und gerade dabei ist, die Sachbuchbestenliste zu erobern. Ein Zufall?! (Siehe hierzu auch unser Sachbuchtipp des Monats März)
Aber: Lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Hanser Verlag, München
Buchtipp des Monats März 2019

© Erna R. Fanger & Hartmut Fanger
Poetischer Abgesang
Einer Grande Dame der Literatur
Elisabeth Borchers: „Nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Ein Fragment“, herausgegeben von Martin Lüdke, Mitarbeit Ralf Borchers. Weissbooks GmbH, Frankfurt am Main 2018
Die aus dem Nachlass publizierten Erinnerungen der 2013 verstorbenen Elisabeth Borchers – bedeutende Lyrikerin und legendäre Suhrkamp-Lektorin – geben vordergründig zunächst einmal Einblick hinter die Kulissen des Literaturbetriebes. Wir werden Zeuge vom Umgang mit Schriftstellern ebenso wie von der Zusammenarbeit zwischen Autor und Lektor. Abgerundet wird das Ganze durch den so erhellend wie feinsinnigen Essay des Literaturwissenschaftlers und Kritikers Martin Lüdke.
Aufhorchen lässt gleich der Titel „Nicht zur Veröffentlichung bestimmt“. Wie gelangt das Fragment dennoch an die Öffentlichkeit. In erster Linie ist dies dem Autor Arnold Stadler zu verdanken, der Elisabeth Borchers noch zu Lebzeiten dazu ermutigt und ihr bis zum Schluss beratend zur Seite gestanden hat. Ihr Sohn Ralf Borchers und Martin Lüdke haben das Fragment nun – fünf Jahre nach ihrem Tod – in dem von Borchers ehemaligen Suhrkamp-Kollegen geführten Weissbooks-Verlag auf den Weg gebracht. Ein Buch, von dem sich neben Literaturbegeisterten nicht zuletzt Leser mit eigenen Schreibambitionen einiges versprechen dürften. So erfährt man zum Beispiel spannende Details aus dem offenbar grundlegend konfliktiven Verhältnis zwischen Lektor und Autor. Ebenso wie von dem nicht selten zutage tretenden Widerspruch, einerseits zwischen Autor und Werk, andererseits zwischen literarischen Kriterien des Verlags und dem Postulat, zugleich marktstrategischen Gesetzen gerecht zu werden. Borchers, als Lektorin hier in der Position ‚zwischen den Stühlen’, fühlt sich in diesem Ränkespiel bisweilen wiederum bis hin zur ‚Selbstverleugnung’ genötigt.
Wie auch immer, erfährt der Leser eines: Selbst bei hoch anerkannten Autoren wird nur mit Wasser gekocht. Und auch der Autor mit großem Namen ist kaum in der Lage, ständig Meisterwerke zu fabrizieren, wie der Öffentlichkeit suggeriert und vom Autor schließlich selbst geglaubt wird.
Mit scharfer Zunge nimmt Borchers im Übrigen keinerlei Rücksicht auf ehrwürdige Meriten und bezichtigt etwa so arrivierte wie augenscheinlich unumstößliche Ikonen des Literaturbetriebs der Hochstapelei, sei es Martin Walser, Jurek Becker, Max Frisch, Uwe Johnson oder Marie-Luise Kaschnitz. Mit Letzterer geriet das Verhältnis Lektor-Autor am Ende regelrecht zum Gefecht, wobei es dann weniger um das Werk, die Arbeit am Text, als viel mehr um Macht und Einfluss ging, wie Borchers selbst zugibt.
Weniger Enthüllungsbuch über die Verlagslandschaft entpuppt sich das Ganze bei fortschreitender Lektüre jedoch als Zeugnis zunehmender Vereinsamung der Autorin und ihres Ringens mit den Beschwernissen des Alterns. Letzteres beklagt zum Teil in Reflexion der nüchternen Betrachtungen desselben in den Worten der Bibel bei Prediger Salomon oder aber der Klage der Psalmisten. In ihren eigenen Worten gibt sie selbst ergreifend zum Besten:
„Ich habe die Welt abgesucht nach Möglichkeiten, nach Haltepunkten. Wie leer die Welt in solchen Stunden ist. Man wirft Netz um Netz aus, sie bleiben leer. Wie ein leer geschöpftes Meer.“
Berührend überdies die Literarisierung von Wunschvorstellungen, die immer wieder in die Realität der Autorin überzugehen scheinen. So etwa im Hinblick auf die Wucht einer unerwidert bleibenden, großen Altersliebe, die Borchers umtreibt und ihre Spuren im Text hinterlässt. Die Enttäuschung über den ausbleibenden Anruf, das unermessliche und zugleich trügerische Glück, mit dem Geliebten ‚gern in Kirchen’ zu weilen, ist dieser doch in den meisten Fällen präsent allenfalls als Abwesender und bleibt für Borchers unverfügbarer Sehnsuchtsort.
„Ein eigenartiges Gefühl, ganz allein in einem so um sich greifenden Raum [einer Kirche] zu sein ... Ich habe in diesen Raum hinein geredet: da bin ich, ganz allein, bitte ... Ich versuchte dich anzurufen. Keine Antwort und das Handy mit der stereotypen Aufforderung: versuchen Sie’s später noch einmal ... Ach ist ein Synonym für Nichtausgesprochenes. Ach. Nichtauszusprechendes“.
Mit „Nicht zur Veröffentlichung bestimmt“ wird uns die „Femme de lettres“ Elisabeth Borchers in Erinnerung bleiben, als scharfe Kritikerin ebenso wie sanftmütig-sehnsuchtsvoll Liebende und stets vortreffliche Lyrikerin.
Aber: Lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Weissbooks Verlag

Buchtipp des Monats Juli 2018
© Hartmut Fanger schreibfertig.com
Nicht nur für Beatles-fans
David Foenkinos: „Lennon“. Aus dem Französischen von Christian Kolb. Deutsche Verlags-Anstalt. DVA, München 2018
Wer die 60er und 70er Jahre verstehen will, der kommt an den Beatles schon zwangsläufig nicht vorbei, nicht an deren Musik und Lebensphilosophie, ebensowenig wie an den Schlagzeilen. Zweifellos waren die Fab Four aus Liverpool weltweit populär. Und der Protagonist war ihr Bandleader John Lennon. Es kommt deshalb auch nicht von ungefähr, dass der gegenwärtige Popstar unter den französischen Autoren, David Foenkinos, einen Roman über die Ikone verfasst hat, der Dank seiner präzisen und umfangreichen Recherche nahezu wie eine Biografie anmutet. Das Ganze mit Anmerkungen und einem Nachwort versehen. Für Fangemeinde, Popwelt und Literaturinteressierte ein Grund zur Freude. Im Übrigen liest sich der Roman ausgesprochen gut und vermittelt das außergewöhnliche Leben Lennons aus der Ich-Perspektive, was besonders nah an die Hauptfigur heranführt.
David Foenkinos John Lennon. Fast kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, als wäre der Autor eine Symbiose mit dem Gegenstand seines Interesses eingegangen. Authentisch, originell und treffend werden im Rahmen von 18 Sitzungen einer Psychoanalyse, zugleich Kapitel, Höhen und Tiefen im Leben John Lennons ausgelotet. Frappierend, wenn der Leser bisweilen das Gefühl nicht los wird, als würde John Lennon ihn von der Couch aus direkt ansprechen, und so unmittelbar aus dessen Leben erfährt. John Lennon reflektiert: von der Kindheit des Protagonisten bis hin zum Beginn der Beatles, von den ersten großen Erfolgen bis hin zu Yoko Ono, vom „Bombenlärm“ des Zweiten Weltkriegs bis hin zu „Give Peace a Chance“, vom ‚ersten Joint’ mit Bob Dylan bis hin zur Heroinsucht. Ein langer Monolog, der jedoch mit keiner Zeile langatmig wird. Im Gegenteil. Mitreißend, von Lennons Umgang mit dem Ruhm, seinem Verhältnis zu Paul McCartney zu erfahren, von seinem Protest gegen den Vietnamkrieg und seinem Kampf darum, während der Zeit Richard Nixons in Amerka bleiben zu dürfen. Zahlreiche nicht weniger berühmte Zeitgenossen treten in Erscheinung oder werden zumindest erwähnt. Sei es George Harrison, Ringo Starr, Mick Jagger, Frank Sinatra, Allen Ginsberg oder Fred Astaire. Nicht zu vergessen, Maharishi-Jogi.
Und es wundert dann auch nicht, wenn Foenkinos im Nachwort bekennt, dass John Lennon ‚ein Teil seines Lebens sei, seine Musik ihn überhall hin begleite und er ihn wahnsinnig bewundere’. Dies ist dem mit Herzblut geschriebenen Roman sehr wohl anzumerken und gewiss zugleich auch sein Stärke. Überraschend, dass Foenkinos erst 1974 geboren ist, er also einen Großteil von Lennons Leben erst im Nachhinein hatte kennenlernen können. Zu allem hin bestand die Schwierigkeit, dass nach Foenkinos ’Lennon seine Biografie selbst wohl mehrmals umgeschrieben hat’. Umso beachtlicher die Leistung. Foenkinos ist mit „Lennon“ ein großer Wurf gelungen.
Doch lesen Sie selbst, lesen Sie wohl!
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt der Deutschen Verlags-Anstalt DVA!




